Landwirte kritisieren bürokratische Belastung
- Veröffentlicht am

Die Bauern und Weingärtner befürchten nicht nur unverhältnismäßig viel Bürokratie, welche das neue Mindestlohngesetz bei der Beschäftigung von Saisonarbeitskräften nach sich zieht, sondern auch den Verlust von Marktanteilen.
Mittelstandsfeindliche Politik kostet Marktanteile
Klaus Brodbeck bringt es gleich in seiner Einführung auf den Punkt: „Durch den Mindestlohn kommen wir in Wettbewerbs- und Kostendruck. Diese mittelstandsfeindliche Politik kostet uns Marktanteile.“ Die Bauernfamilien würden dadurch bürokratisch über Gebühr belastet, kritisiert Stuttgarts Bauernverbands-Vorsitzender. Familienarbeitskräfte müssten auf alle Fälle von den umfassenden Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten befreit werden, fordert Brodbeck. Kurzfristige und versicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse sollten von den Mindestlohnregeln ausgenommen werden, legt er nach.
Gesetzlicher Mindestlohn wird alle zwei Jahre angepasst
Sie spreche über ein „nicht ganz so erfreuliches Thema“, bekennt Nicole Spieß fast entschuldigend. Die Rechtsanwältin und Sozialrechtsreferentin des Landesbauernverbandes (LBV) erklärt, was die Landwirte seit Januar dieses Jahres in Folge des Mindestlohngesetzes alles beachten müssen. Ihr Vortrag dauert lange, fast eineinhalb Stunden. Darin zeigt sich tatsäch-lich die Vielzahl an Paragrafen, welche es zu berücksichtigen gilt.
Der Mindestlohn beträgt 8,50 Euro brutto seit 1. Januar 2015. Er wird alle zwei Jahre ange-passt, erstmals zum 1. Januar 2017. Legt man die durchschnittliche Lohnentwicklung von zwei bis drei Prozent zugrunde, halten Experten rund 8,93 Euro je Stunde 2017 und fast zehn Euro 2019 für realistisch. Die im Koalitionsvertrag zugesagte besondere Berücksichtigung der Probleme bei der Saisonarbeit erfolgte nicht, moniert Spieß.
Bundeslohntarifvertrag gilt für Saisonkräfte
Für die Jahre 2015 bis 2017 gilt in der Landwirtschaft eine Übergangsregelung. Der gesetzli-che Mindestlohn wird dabei aufgrund eines allgemeinverbindlichen Bundestarifvertrages unterschritten. Dieser Bundeslohntarifvertrag gilt für Land- und Forstwirtschaft sowie Gar-tenbau und beinhaltet Brutto-Stundenlöhne von 7,40 Euro ab Januar 2015, 8,00 Euro 2016, 8,60 Euro 2017 und 9,10 Euro ab 1. November 2019.
Der Mindestlohn gilt auch für geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte, also Sai-sonarbeitskräfte, sowie Arbeitnehmer von ausländischen Werkvertragsunternehmen.
Ausnahmen vom Mindestlohn gelten für Auszubildende, Jugendliche unter 18 Jahre; Prakti-kanten, die ein Pflicht-, Orientierungs- oder berufsbegleitendes Praktikum von maximal drei Monaten absolvieren. Für mitarbeitende Familienangehörige ist der Mindestlohn ebenfalls gültig, wenn diese den Status von Arbeitnehmern haben.
Anrechnung von Kost und Logis nicht einfach möglich
Sind die Voraussetzungen für den Mindestlohn gegeben, können Arbeitnehmer nicht einfach ihren Verzicht darauf erklären. Der Mindestlohn ist je Zeitstunde zu berechnen. Akkordlohn ist zulässig, wenn der Mindestlohn für die geleisteten Arbeitsstunden erreicht wird. Akkord- und Leistungsprämien zählen nicht zum Grundlohn! Ebenso Gefahrenzulagen, Erschwerniszu-schläge, Sonn-, Feiertagszuschläge und Ähnliches.
Die Anrechnung von Kost und Logis ist grundsätzlich nicht zulässig. Aber im Falle der Saisonarbeit ist das möglich, allerdings nicht für tarifliche Mindestlöhne! Sachleistung und Lohn können jedoch gegeneinander aufgerechnet werden. Das ist jedoch nur bis zur Pfändungs-freigrenze möglich, die von den individuellen Verhältnissen abhängt, beispielsweise der Zahl unterhaltspflichtiger Kinder. Zudem muss die Aufrechnung im Vertrag stehen. Der Zoll akzeptiert die Aufrechnung ohne weitere Nachprüfung, wenn die zwei getrennten Rechtspositionen Lohn sowie Kost und Logis unabhängig voneinander dokumentiert sind. Alternativ besteht die Möglichkeit, Sachleistungen in einem separaten Vertrag zu vereinbaren.
Geld muss bei Fälligkeit fließen
Wann muss der Mindestlohn gezahlt werden? Bei Fälligkeit! Für das Ministerium heißt das: Das Geld muss Ende des Monats fließen, der auf den Monat der Arbeitsleistung folgt. Bei Beschäftigung beispielsweise von 25. April bis 20. Juni: muss die ‚Zwischenauszahlung‘ für April bis Ende Mai erfolgen usw.
Bei das ganze Jahr über fest angestellten Minijobbern auf 450 Euro-Basis kann bei 40 Stun-den je Woche Regelarbeitszeit im Falle von Arbeitszeitkonten nur im Rahmen von plus fünf bis minus drei Stunden wöchentlich abgewichen werden. Arbeitszeitkonten sind also in Landwirtschaft nicht praktikabel.
Arbeitszeitgesetz verlangt Dokumentation der Arbeitszeiten
Nach dem Arbeitszeitgesetz müssen die Betriebe die Arbeitszeit der Saisonkräfte genau do-kumentieren. Die werktägliche Arbeitszeit der Saisonkräfte beträgt durchschnittlich acht Stunden und kann bis auf zehn Stunden verlängert werden. Das geht allerdings nur, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden, erklärt Spieß.
Zudem besteht nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) und dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) eine verschuldensunabhängige Auftraggeber- und Generalunternehmerhaftung (§§ 13 MiLoG, 14 AentG), erläutert die LBV-Sozialrechtsreferentin.
Eingangs hatte sich Klaus Brodbeck über das zahlreiche Erscheinen der Bezirksbeiräte, Vertreter aus der Verwaltung und Politiker erfreut gezeigt. Die gute Resonanz zeige deren Interesse an der Landwirtschaft. Den Kontakt der Bezirksbeiräte zur Landwirtschaft hält er für sehr wichtig.
Der Strukturwandel sei in der Großstadt schwieriger zu kompensieren. Die Flächen hätten hier einen ganz anderen Wert. Landwirtschaftliche Nutzflächen seien knapp. Das betonte Dagmar Wenzel, Ortsvorsteherin von Untertürkheim, in ihrem Grußwort. Anwesend waren unter anderem auch ihre Kollegen aus den Stuttgarter Stadtteilen Plieningen und Mühlhausen.
Die Landwirtschaft in der Großstadt sei „urban geprägt“, sagt Wenzel. Die Lebensmittelproduktion sei nur ein Aspekt der Leistungen der Landwirtschaft. Hinzu kämen Dienstleistungen wie zum Beispiel Hof-Cafés, Direktvermarktung, Lernvermittlung an Schulen, für Mitbürger und vieles mehr.
Der Karl-Benz-Platz in Untertürkheim sei in „schlechtem Zustand“. Da kommt Wenzel die Idee, diesen als „Bienenweide“ zu nutzen. Untertürkheim könne von den Bauern profitieren. Die Ortsobmänner seien wichtige Ansprechpartner im Bezirksbeirat. Warum nicht Obst oder Kartoffeln auf dem Karl-Benz-Platz anbauen, fragt Vorsitzender Brodbeck. „Da findet sich bestimmt ein Bauer“, ist er zuversichtlich.
Zwanglose Ferkel-Tour auf dem Motorrad
„Die Diskussion um ‚Massentierhaltung‘ belastet unseren Berufsstand erheblich“, bedauert der Vorsitzende. Dazu erzählt er eine Geschichte in Bildern. Die Deutsche Anna besucht eine afrikanische Familie und schenkt ihr ein Ferkel zu Weihnachten. Anna und ‚Daisy‘ – das junge Borstenvieh im Sack, damit es nicht ausbüchst – touren auf dem Motorrad vier Stunden lang Richtung Hauptstadt, wo sie herzlich aufgenommen werden und sich Daisy zum netten Spielkameraden entwickelt. Ferkel und Familie sind wohlauf. Die Szene mutet idyllisch an. Der „zwanglose“ Umgang mit Nutztieren erscheint typisch.
Würde man die Bilder nochmals zeigen, kämen dem deutschen Betrachter bestimmt Zweifel. Er sähe rechtliche Verstöße beim Transport, bei der Tierkennzeichnung, Futtermitteluntersuchung etc., meint Brodbeck.
So gibt es in Stuttgart derzeit keine Schweinehaltung und keinen Schlachthof mehr. Bei einer großen Anzahl an Verbrauchern mit über 50 kg Fleischverzehr je Kopf und Jahr gibt es kaum Fleischerzeuger in der Landeshauptstadt. Der Verbraucher wünscht hochwertiges Fleisch und Wurst ebenso wie tiergerechte Haltung. „Wie ist dies zu vereinbaren?“, fragt sich der Betrachter.
Appell zur Unterstützung der ‚Initiative Tierwohl“
Landwirte müssen zeigen, dass sich ihre Nutztiere wohlfühlen; hier herrscht noch erheblicher Nachholbedarf an Öffentlichkeitsarbeit, zeigt sich der Vorsitzende selbstkritisch. Die Haltungsformen haben sich verändert; es gäbe keine Rückkehr zu 20 Hühnern oder Schweinen, die sich im Mist suhlen. „Die Versorgung der Bevölkerung „kann nur mit moderner Landwirtschaft erfolgen“, erklärt er. „Die Initiative Tierwohl des Bauernverbandes ist ein kleiner und wichtiger Schritt in diese Richtung. Nur, wenn wir sie unterstützen, kann es zukünftig Fleisch aus Baden-Württemberg geben“, meint Brodbeck.
Der Vorsitzende ließ das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) nochmals Revue passieren. Die Landwirtschaft habe dabei „großen Eindruck“ hinterlassen. Sein besonderer Dank gilt Oberbürgermeister Fritz Kuhn für dessen Unterstützung dieser größten süddeutschen Fachmesse im Veranstaltungsjahr.
Ebenso geht Brodbeck kurz auf die wenig erfreuliche wirtschaftliche Situation der Landwirt-schaft und des Weinbaus ein. Baden-Württemberg rangiert bei den Unternehmensergebnissen der Haupterwerbsbetriebe seit vier Jahren im Bundesdurchschnitt auf dem letzten Platz. Acker- und Weinbau hatten im Wirtschaftsjahr 2013/14 das größte Minus zu verzeichnen.
Programm zur Förderung von Trockenmauern und Weinbau in Steillagen kommt gut an
Sehr positiv beurteilen die Stuttgarter Bauern und Weingärtner das neue städtische Programm zur Förderung des Aufbaus von Trockenmauern und des Weinbaus in Steillagen. Jähr-lich lässt sich das die Landeshauptstadt 600.000 Euro. Kosten. Als „kleinen Wermutstropfen“ bezeichnet der Vorsitzende, dass der Zuschuss bisher noch von einer Eintragung im Grundbuch abhängig ist. Doch da zeichne sich mit der Verwaltung eine gangbare Lösung ab, berichtet Brodbeck.
Neuerungen beim Gemeinsamen Antrag 2015
Luise Pachaly, Fachbereichsleiterin Landwirtschaft im Landratsamt Ludwigsburg, erläutert die wesentlichen Neuerungen beim Gemeinsamen Antrag 2015. Mit dem Programm ‚Flächeninformation und Online-Antrag‘ (FIONA) kann dieser seit diesem Jahr nur noch online gestellt werden. 2014 erfolgten noch 16 Prozent der Anträge auf Papier. Pachaly verweist auf die FIONA-Schulungen des Fachbereiches Landwirtschaft. Denn das Grundstücksverzeichnis kann ab 2015 nur noch online erstellt und über FIONA ausgedruckt werden. Sie appelliert an die Betroffenen, sich bald bei der unteren Landwirtschaftsbehörde zu melden und die Schulungen früh zu nutzen.
Beim Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) wird die endgül-tige Zustimmung der EU-Kommission Ende 2015 erwartet. Bis dahin haben die Bescheide vorläufigen Charakter.
Der Versand der Informationsunterlagen für den Gemeinsamen Antrag erfolgt ab Anfang März und soll bis 13. März 2015 abgeschlossen sein. Termine zur Antragsabgabe müssen 2015 in einem vier Wochen kürzeren Zeitraum als im Vorjahr unterzubringen sein. Das sei eine „besondere Herausforderung“ für die Verwaltung, meint die Fachbereichsleiterin.
Die Pheromon-Förderung im Weinbau und die Steillagenförderung für Grünland erfolgen ab 2015 nicht mehr in FAKT, sondern in eigenständigen Landesprogrammen (siehe BWagrar 9/2015, Seite 10 bis 12 und 8/2015, Seite 12).

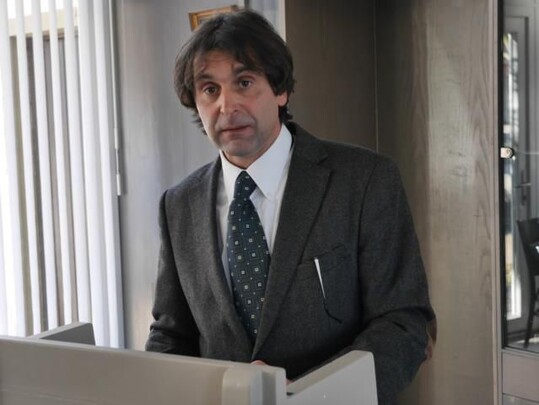
















Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.