ADO legt solide Zahlen vor
- Veröffentlicht am

Bei der ADO profitierte man 2019 von den vergleichsweise guten Preisen für Schlachtschweine, berichtete Geschäftsführerin Renate Mayer. Der Strukturwandel allerdings sorgte dafür, dass man die Vermarktungsstückzahlen von 2018 nicht mehr erreichen konnte. Manche Ställe blieben leer, einige Betriebe gaben ihre Schweinehaltung komplett auf. Im Jahr 2019 hat die ADO insgesamt 101.383 Schweine vermarktet (Vorjahr: 115.089). Bei den Mitgliederzahlen waren zum 1. Januar 2020 noch 113 Mitgliedsbetriebe, sieben weniger als im Vorjahr. Dank der höheren Auszahlungspreise stieg der ADO-Umsatz um 1,24 Mio. Euro auf 15,36 Mio. Euro. Dass die ADO seit Jahren sparsam wirtschaftet, zeigt der geringe Kostenanteil am Jahresumsatz von nur 1,05 Prozent. Der Gewinn betrug 64.000 Euro und es konnten insgesamt knapp 17.000 Euro Prämiengelder ausgeschüttet werden.
Die Anfangsjahre waren hart
Gegründet werden konnte die ADO mit finanzieller Unterstützung der regionalen Bauernverbände. Beim Bauernverband Biberach konnte sie Räumlichkeiten für ihre Geschäftsstelle angemieten, wofür sich Theo Völk, Gründungsmitglied und heute noch ADO-Vorsitzender, bedankte. Die ADO-Gründung war am 17. Juli 1995 im Gasthof Hirsch in Dellmensingen. Gründungsväter waren neben Theo Völk, Ewald Selig, Josef Beck, Reinhold Schmid, Rainer Leicht, Josef Rief und Hans-Jörg Baier. Die Anfangszeiten waren geprägt von ständigen Geldsorgen, Personalwechsel und der Suche nach neuen Mitgliedern. Dank des langjährigen Geschäftsführers Maximilian Kolb, der vor zwei Jahren in den Ruhestand ging, konnten seit Mitte der 2000er-Jahre erstmals Rücklagen gebildet werden, berichtete Mayer. Aktuell gibt es noch 19 Mitglieder aus der Gründungszeit, von denen ein Großteil anwesend war.
Landwirtschaft muss wichtig bleiben
Theo Völk erinnerte an die unruhigen Zeiten bei der ADO-Gründung, als es alles andere als einfach war, eine Erzeugergemeinschaft ins Leben zu rufen angesichts geringem Startkapital und dem ständigen Risiko, dass die Schweine nicht zu dem für die Mitglieder erforderlichem Preis verkauft werden können. Völk kritisierte, die Art und Weise wie momentan mit der Landwirtschaft umgegangen werde. "Ohne Landwirtschaft gibt es keine Nahrungsmittel. Vielleicht müssen die Regale mal eine Zeit lang leer bleiben, damit manche Leute wieder kapieren, um was es geht", meinte der Vorsitzende.
Handel mit CO2-Zertifikaten im Kommen
Gastredner war Wolfgang Abler, Geschäftsführer der CarboCert GmbH. Er sprach über Humusaufbau mit Hilfe von CO2-Zertifikaten. Ein spannendes Zukunftsthema, welches den Tierhaltern neue Möglichkeiten eröffnet, die Fruchtbarkeit ihrer Böden zu verbessern und gleichzeitig zur Verlangsamung des Klimawandels beizutragen. Abler betonte in seinem Vortrag, dass man den Klimawandel nur mit der Landwirtschaft gemeinsam in den Griff bekommt. „Die Landwirtschaft ist die Achilles-Sehne der Gesellschaft, man darf sie nicht kaputtmachen“, warnte Abler.
Humus geht weiter zurück
Dabei nehmen die Gefahren durch den Klimawandel zu. Laut Abler schreibt der Weltklimarat 24 Prozent der Klimagasemissionen der Landwirtschaft zu. Seit Beginn der Landbewirtschaftung 1750 hätte man in der Landwirtschaft zwischen 20 und 80 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar verloren. „Unsere Kohlenstoffvorräte auf den Feldern gehen kontinuierlich zurück“, mahnte Abler. Das müsste sich ändern, denn sonst verliere man zu viel fruchtbaren Boden, der dringend benötigt wird. Alle fünf Sekunden verliert die Erde eine landwirtschaftliche Fläche in der Größe eines Fußballfeldes. Wenn dies so weitergeht, könnten bis 2050 schätzungsweise 90 Prozent der Landflächen degradiert sein, zitierte Abler eine Warnung der Food and Agriculture Organisation (FAO) in Rom. Stichwort Wetterkapriolen: Zwei richtig starke Regenfälle können die Humusmenge abschwemmen, die die Natur in 200 Jahren aufgebaut hat, berichtete Abler. So kommt es zu N-Auswaschungen und zu Bodenverlusten. Auch beim Blick auf die Wasserverfügbarkeit erkenne man die Langzeitfolgen des Klimawandels. So nehme die Verfügbarkeit des Wassers mit der Bodentiefe deutlich ab. In Ostdeutschland gibt es bereits viele Böden, die in 50 cm Tiefe ausgetrocknet seien. „Höchste Zeit also, dass wir unsere Böden pflegen und fruchtbar halten“, findet Abler.
Den Stickstoff richtig einsetzen
Humus besteht zu 58 Prozent aus Kohlenstoff und zu sechs Prozent aus Stickstoff, sagt Abler. Um ein Prozent Humus pro ha aufzubauen, seien 50 Tonnen (t) C02 und 2,5 t N erforderlich. „Wenn man das clever macht, mit der richtigen Kohlenstoffquelle, dann ist das eine positive Sache. Wir brauchen den Stickstoff. Wir müssen ihn aber mit dem Kohlenstoff zusammenbringen“, so Abler. Dies kann manchmal schwierig sein, wie das Beispiel eines Hühnerhalters zeigt. Der Hühnerbauer bringt den Hühnermist auf die Körnermaisstoppelfelder nach der Ernte. Der Stickstoff soll helfen, dass sich die Stoppel optimal zersetzen. Der Hühner-Landwirt ist aber in einem roten Gebiet und darf hier im Herbst keinen Mist mehr ausbringen. Also trocknet er den Mist aufwändig, bringt ihn schon im Sommer aufs Feld, so dass der Stickstoff zum Herbst hin verfügbar wird. „Das ist viel aufwändiger bei sonst gleichem Effekt und bringt deshalb eigentlich nichts“, so Abler.
Maßnahmen für den Humusaufbau
"Der Kohlenstoff steckt zu 750 Mrd. t in der Atmosphäre, 660 Mrd. t in den Pflanzen und 1500 Mrd.t in den Böden. Wenn wir auf die Böden aufpassen und nicht zu viel entweichen lassen, dann bremsen wir auch den Klimawandel, “ erklärt Abler. Gerhard Weishäupl aus Österreich beispielsweise habe es laut Abler geschafft, die Humusgehalte seiner Böden in vier Jahren um 2,6 Prozent zu erhöhen. Wichtig sei keine Düngung in der Hauptkultur. Gedüngt wird nur in der Zwischenfrucht. Als Dünger nimmt er 20 t Bokashi pro ha. Bokashi ist ein fermentiertes organisches Material und kommt ursprünglich aus Japan. Gefragt seien Untersaaten, Zwischenfrüchte, Mischkulturen, Bakterieneinsatz, Minimalbodenbearbeitung, Tiefenlockerung sowie eine Mulchabdeckung wenn möglich. Wichtig für den Kohlenstoff-Kreislauf seien die Wiederkäuer, die das Grünland beweiden. So bekommen die bodenbürtigen Bakterien ihre Nahrung. In einem Managementvergleich schneiden die Betriebe ohne Pflug, mit Tierhaltung, ohne Chemieeinsatz und einer hohen Diversität am bsten ab.
Beispielkalkulation
Beim CO2-Zertifikatenhandel, den Abler über seine Firma betreibt beziehungsweise vermittelt, zeigt er eine Beispielkalkulation für einen 30 ha Betrieb: Die Laufzeit geht über 10 Jahre. Pro Jahr und Hektar sollen 3 Tonnen C02 aufgenommen werden. Dafür gibt es dann für den Landwirt pro t C02 einen Betrag von 30 Euro als Einnahme (= 90 Euro pro ha und Jahr). Dem stehen aus Ausgaben die Kosten für die Bodenproben gegenüber. Beprobt wird drei Mal, insgesamt sind das Kosten in Höhe von 4100 Euro pro Betrieb. Abler spricht hier von einem Deckungsbeitrag in Höhe von rund 22.000 Euro in zehn Jahren.
Greenwashing liegt im Trend
Die Proben werden GPS-genau entnommen und die Ergebnisse (Gesamtstickstoffgehalt sowie P/N-Verhältnis) in einer Datenbank gespeichert und dokumentiert. An dem Zertifikatenhandel hängt ein ganzer Firmenverbund mit dran, den Preis der Papiere legt die Bundesregierung fest. Industrieunternehmen, die mehr C02 ausstoßen als sie selber verbrauchen, können über den Handel ihre CO2-Bilanzen verbessern, Stichwort „Greenwashing“. Tun sie dies nicht, drohen ihnen Strafzahlungen der EU, meint Abler. Laut Abler hat die 2006 gegründete CarboCert mittlerweile über 270 Landwirte mit 13.000 Hektar unter Vertrag. Das seien rund 50.000 t Co2 Eintrag, was rund 333 Mio. gefahrenen Autokilometern entspreche. Da es in Deutschland rund 11,4 Mio. ha landwirtschaftliche Fläche gibt, gebe es noch jede Menge Potenzial, so Abler und hofft auf weitere Betriebe, die mitmachen.
Positive Erfahrungen beim Humusaufbau
Positive Erfahrungen beim Humusaufbau hat ADO-Mitglied Rainer Müller aus Backnang gemacht. Müller hat 2018 die Regenerative Landwirtschaft kennengelernt, sagt er. Dabei habe er gelernt, dass der viehhaltende Betrieb seine Gülle aufbereiten und behandeln sollte, um den Bodenbakterien die Arbeit zu erleichtern. Außerdem probiert er in der Fruchtfolge den "Wintergrünen-Acker" aus, das gelingt durch winterharte Zwischenfrüchte. Vor dem Maisanbau hat er eine Pflegerotte durchgeführt, was dazu führte, dass beim Starkregen im Mai kein wertvoller Boden mit wegschwemmt wurde.




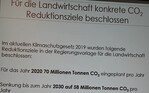








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.