Landwirtschaft als Sympathieträger
- Veröffentlicht am

Zur Tagung konnte Stefan Käppeler, VLF-Vorsitzender, zahlreiche Amts- und Schulleiter, Geschäftsführer der VLF-Kreisverbände sowie Ehemalige und Gäste begrüßen. Im ersten Gastvortrag stellte Stefan Simma, Direktor der Landwirtschaftskammer Vorarlberg, die Landwirtschaft im kleinsten österreichischen Bundesland vor. Vorarlberg gilt als Vorbild in der regionalen Vermarktung. Anschließend folgten Vorträge von Matthias Knödlseder, Bayerwald GbR, zum Thema Milchviehkooperation und von Christoph Hönig, Hönig-Hof GmbH, über die 08er Eier aus Baden-Württemberg sowie von Clemens Mauch, Beratungsfirma Bischoff & Hager.
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sichern
"Wie können wir den Arbeitsplatz Bauernhof sichern, um genügend Einkommen zu erzielen?, lautete eine zentrale Frage im Vortrag von Stefan Simma, Direktor des Landwirtschaftskammer Vorarlberg, der es begrüßen würde, wenn sich die Bauern über die Grenzen hinweg noch besser vernetzen würden. In Vorarlberg angesagt seien Erwerbskombination, Zweiteinkommen, Vielfalt: Letztendlich, so Simma, komme es auf das Gesamteinkommen der Familie an. „Betriebe, die nur produzieren, ohne irgendein anderes Standbein zu haben, gibt es bei uns so gut wie keine mehr“, sagte Sinner.
Klares Bild in der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeitsarbeit habe man gebündelt. Der Grund: "Wir reagieren zu viel und agieren zu wenig", so Simma. Hier möchte man künftig noch besser und effektiver zusammenarbeiten. "Wir haben viele junge, motivierte Hofnachfolger, so Simma. Die Unterstützung der Landwirtschaft durch die Bürger sei in Vorarlberg gegeben. Gemeinsames Ziel sei es, sowohl die Grünzonen als auch die ertragreichen Flächen zu schützen. Kurze Wege und das nachhaltige Wirtschaften im Forst und auf dem Grünland liefere gute Antworten auf die Herausforderungen durch den Klimawandel. In Vorarlberg gibt es rund 25.000 Milchkühe und etwa 3500 landwirtschaftliche Betriebe. Dazu gehören 530 Almen, darunter rund 150 die ihre Milch selber verarbeiten. Die Sennereien seien größtenteils Genossenschaften und stünden so im Eigentum der Lieferanten. "Wenn wir das intensive Grünland verlieren, könnten auch die Almen nicht mehr bewirtschaftet werden. Die komplette Tierhaltung ginge verloren", gab Simma zu bedenken. Der Viehbesatz liegt beträgt 0,8 GV pro ha. Leitprodukte der Milchwirtschaft sind der Bergkäse und der Sauermilchkäse.
Mit Qualität und Tourismus gut im Geschäft
„Uns wird gerne der Vorwurf gemacht, dass wir zu viel Milch produzieren“, sagt Simma. Seiner Meinung nach sei das Gegenteil der Fall. Die Frischmilchversorgung liege bei deutlich unter 20 Prozent. 90 Prozent der Milch wird zu Käse verarbeitet. „Wir durften von den Schweizern lernen, wie man Käse macht.“ Seit über 30 Jahren gehe es uns darum, Qualität und Wertschöpfung zu verbessern. Der Weg habe sich bewährt. Es gebe eine große Molkerei, die Vorarlberg Milch in Feldkirch. Die Milchpreise seien wegen der insgesamt höheren Produktionskosten (u.a. komplett GVO-frei) ebenfalls auf einem hohen Niveau, bei den manchen Sennerein werden bis zu 60 Cent pro kg (brutto) bezahlt. Das Thema Heumilch komme aus Österreich. Hier habe man die Werbung gut ausgebaut und damit sehr viel erreichen können. Die Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof hätten sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Mit dem Ausbau der alten Bauernhäuser mit Ferienwohnungen lasse sich gut Geld verdienen. Urlaub auf dem Bauernhof ist eine Marke und wird in Österreich auch über den Tourismusverband hervorragend beworben.
So kann eine erfolgreiche Milchviehkooperation aussehen
Mehr verdienen, weniger arbeiten und mehr Freizeit: das versprechen sich die verschiedensten Kooperationsmodelle. Aber halten sie auch ihr Versprechen? So bestechend sich diese Formen des Zusammenschlusses anhören, so wenig haben sie sich in der Praxis tatsächlich durchgesetzt, merkte der VLF-Vorsitzende einleitend, mit Blick auf den bevorstehenden Vortrag von Matthias Knödlseder an. Knödlseder ist einer, der es geschafft habe, eine Kooperation über 15 Jahre erfolgreich am Leben zu halten. Die Bayerwald GbR aus Hauzenberg liegt in der Nähe von Passau unweit der tschechischen Grenze. Startschuss der GbR war 2004, als sich sechs Landwirte zusammengetan haben, um gemeinsam einen Milchviehstall zu bauen. Knödlseder, damals noch Student und Milchprüfer, war rund zwei Jahre lang auf der Suche nach Kooperationspartnern für seinen elterlichen Milchviehbetrieb. Einen Standort finden, den Stall bauen und vor allem einen guten Kooperationsvertrag ausarbeiten: das waren die Herausforderungen.
Grunddaten: Am 1.12.2005 wurde der neue Stall bezogen. Eingebracht in die Kooperation haben die sechs Familienbetriebe 90 Hektar eigen, plus die Pachtflächen. So hatte die GbR dann insgesamt 178 ha Fläche zur Verfügung. 220 Kühe plus 185 Nachzuchttiere. Einige Jahre später stieg die Zahl der Kühe auf 270 (260 Rinder), die Fläche auf 211 Hektar, die Milchquote auf 1,6 Mio. kg und auch der Stalldurchschnitt stieg an. Bei dem Stall handelt es sich um einen Außenklimastall mit 228 Liegeboxen, mit einer Holz-Beton-Konstruktion. Es gibt Tiefbuchten mit Einstreu, Stroh- Kalkwasser-Gemisch, Seilschieber-Entmistung und einen Abkalbestall auf Tiefstreu. Der Güllebehälter hat 2000 Kubikmeter Fassungsvermögen, wobei die einzelnen Betriebe nach wie vor ihre Güllebehälter (3500 m3) in den Dörfern zur Verfügung stellten, so dass man für die Gülle bsi heute stets genügend Kapazitäten hatte. Einer der Kooperationspartner hatte seinen Betrieb fürs Jungvieh zur Verfügung gestellt und die weitesten Flächen liegen 5 Kilometer vom Stall entfernt.
Arbeitsorganisation: Für die Arbeitserledigung gibt es einen durchgetakteten Dienstplan. Jeder der sechs Gesellschafter (AK 1 bis 6) macht jede Arbeit die nötig ist. Wer ausfällt, muss für Ersatz sorgen, am besten mit einer Person aus der Gesellschaft. Die Arbeiten müssen protokolliert werden, damit der andere in der nächsten Schicht daran anknüpfen kann. Für die Stallarbeit sind im Jahr 9125 Stunden angesetzt. Nach vier Tagen Arbeit hat eine Arbeitskraft laut Diensplan anschließend 8 Tage lang frei. Nach 84 Tagen hat jeder an gleich vielen Sonntagen arbeiten müssen. Im Stall gibt es eine Stempeluhr, die Arbeit zuhause muss man sich aufschreiben. "Bezahlt werden ausschließlich die geleisteten Stunden, keine Pauschalpreise. Das ist das gerechteste System. Wer nichts arbeitet, bekommt auch kein Geld, wobei der Stundenlohn für alle Gesellschafter, unabhängig vom Ausbildungsstand, gleich hoch ist", erläuterte Knödlseder. Entsprechend der Kompetenzen der Gesellschafter und der anfallenden Arbeit wurden sechs Abteilungen geschaffen, mit jeweils einem Abteilungsleiter. Die Abteilungen sind: Herdenmanagement, Buchhaltung, Technik, Zucht- und Tiergesundheit, Außenwirtschaft und Jungviehaufzucht.
Kooperationsanteil und Gewinnanteil
Die eingebrachten Produktionsfaktoren (Boden, Arbeit, Kapital) sind in der Kooperation gebunden. Kapital zum Beispiel bleibt solange drin, bis einer aussteigt oder bis der Vertrag nach 20 Jahren ausläuft. Die Fläche kann man nicht entnehmen, sie muss weitere 12 Jahre drinbleiben. Gebäude ebenfalls. Alle Viehwerte, Milchquoten, Investitionswerte werden zusammengerechnet. Daraus errechnet sich der Anteil an der Kooperation. Dieser Kooperationsanteil ist aber nicht der Gewinnanteil. Wer zum Beispiel 21 Prozent Anteil an der Kooperation hält, bekommt nicht automatisch auch 21 Prozent vom Milchgeld. Schließlich müssen die eingebrachten Flächen, die Maschinen, die Arbeit und die baulichen Anlagen ebenfalls entlohnt werden. Den Kooperationsanteil braucht man für das Stimmgewicht bei Beschlüssen und für die Höhe der Dividende.
Die Mehrheit entscheidet
Wenn man in der Kooperation zum Beispiel darüber nachdenkt, einen neuen Futtermischwagen anzuschaffen, müssen mindestens 51 Prozent der Stimmanteile sich dafür aussprechen (einfache Mehrheit). Bei sechs Gesellschaftern, sind das in der Regel mindestens drei oder sogar vier Personen, die dafür sein müssen. Bezahlt wird so ein Futtermischwagen vom Milchgeld über das Girokonto. Der Gesellschafter mit 40 Kühen hat dann einsprechend einen höheren Anteil am Futtermischwagen als der Gesellschafter mit 20 Kühen.
Eine zweit Drittel Mehrheit ist erforderlich, wenn ein Gesellschafter ausgeschlossen oder ein neuer aufgenommen werden soll. Bei einer anstehenden Wachstumsinvestition (z. B. neuer Stall oder eine Biogasanlage) müssen alle bis auf einen dafür sein. "Das hat man so geregelt, damit nicht einer alles blockieren kann", so Knödlseder. Grundsätzlich müssten alle Gesellschafter kompromissbereit sein und auch mal Fehler zugeben können. Im Mittelpunkt stehe stets die Rentabilität und weniger die Frage, ob der Traktor „grün“ oder „rot“ sein soll.
So wird ausbezahlt
Für den Jahresgewinn eines Gesellschafters wird das insgesamt eingenommene Betriebseinkommen in einem ersten Schritt budgetiert und auf die eingebrachten Produktionsfaktoren verteilt. In einem zweiten Schritt wird es anteilig an die jeweiligen Gesellschafter ausgeschüttet. Am Jahresende kann es sein, dass es noch eine Dividende gibt.
Alles richtig gemacht
Knödlseder zieht ein positives Fazit: Unterm Strich, sagt er, gab es für alle Beteiligten deutlich mehr Freizeit als vor der Kooperation. "Ich habe wieder mehr Zeit zum Musik machen und für die Familie". Einige konnten sich ein zweites Standbein aufbauen. Knödlseder zum Beispiel habe seine PC-Firma weiter ausbauen können, ein anderer Gesellschafter sei in die Gastronomie eingestiegen. Mittlerweile sieht es so aus, dass es bei allen sechs Betrieben keinen Hofnachfolger gibt. So wird die Kooperation vermutlich, Stand heute, mit Auslaufen des Vertrages 2025 aufgelöst werden. Dieses Nachfolgeproblem jedoch gab es bereits von Anfang an und habe eigentlich nichts mit der Kooperation an sich zu tun gehabt.
Kooperationen in der Familie und mit Freunden sind riskant
"Bei uns gab es vor der Kooperation keinerlei Freundschaften. Wir haben uns gekannt, aber mehr auch nicht", sagt Knödlseder. Dies sei die gesündeste Ausgangssituation. Auch vom Alter her, die Partner waren 30 bis 60 Jahre alt, gab es große Unterschiede. Es galt das Motto: Je mehr Personen desto besser, damit man einfacher Mehrheiten finden kann. Je weniger Gesellschafter es sind, desto detaillierter muss der Vertrag ausgearbeitet werden, so sein Credo. Das bestätigte auch Clemens Mauch, der aus seiner Beratungspraxis berichete. Kooperationen können nach seiner Erfahrung in vielfältigster Form geschlossen werden, von der Vermarktungsgemeinschaft bis zur Vollfusion. Bei Vollfusionen rät er davon ab, dies mit Freunden, mit unmittelbaren Nachbarn oder innerhalb der Familie zu unternehmen. „Da kann viel kaputt gehen“, so Mauch. Eine gute Form der Kooperation ist die Milchviehhaltung und die arbeitsteilige Färsenaufzucht, aber auch das sollte nicht unbedingt in unmittelbarer Nachbarschaft erfolgen.
Tipps für die Mitarbeitersuche
Ein wichtiger Punkt in der Landwirtschaft ist die Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier empfiehlt Clemens Mauch, die volle Medienbreite für die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu nutzen. „Fachblätter werden nur von zwei Prozent der Bevölkerung gelesen," so Mauch. Sein Tipp: "Suchen Sie für die Person, die Sie finden, die passende Arbeit und nicht für die Arbeit eine passende Person. Das gibt mehr Arbeitszufriedenheit und die Chance auf längere Zusammenarbeit."
Baden-württembergische Eier - eine Erfolgsgeschichte
Ein vielversprechendes Vermarktungskonzept für baden-württembergische Eier stellte Christoph Hönig, Geschäftsführer der Hönig-Hof GmbH aus Mühlingen vor. Bevor Hönig als 24-Jähriger den elterlichen Hühnerhof übernommen hatte, war er vier Jahre lang auf Weltreise, sagt er. Eigentlich wollte er Außenwirtschaft studieren, bis ihm klar wurde, dass sein Herz für die Landwirtschaft schlägt und Essen und Ernährung weltweit wichtige Themen sind. „Mein Anliegen jeden Tag ist, dass wir für das was wir machen, besser entlohnt werden,“ schilderte Hönig seine Motivation.
Die jungen Wilden werden erwachsen
Heute gibt es auf dem Hühnerbetrieb von Hönig 70.000 Hühner verteilt auf vier Standorte. Organsiert ist Hönig mit 42 anderen Hühnerhaltern im Land in der so genannten 08er-Gruppe. 08 steht für Baden-Württemberg. „Wir sind ein lockerer Zusammenschluss, “ so Hönig. Früher habe man sich als die jungen Wilden bezeichnet. Aus diesen jungen Wilden von damals ist heute einer der wichtigsten Marktpartner für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) geworden. Angefangen in den 90er-Jahren begann das Interesse an Regionalität. "Mein erster Kunde war Edeka Baur in Konstanz", erzählt Hönig. Die ersten Freilandställe kamen auf. 2004 kam die Kennzeichnungspflicht. Von da an war ein Ei mit dem Ländercode 08 erstmals klar zuzuordnen. Eine große Packstelle in Offenburg zum Beispiel mit damals noch vielen Eiern aus Frankreich und Holland musste daraufhin den Betrieb ziemlich schnell einstellen.
So lässt sich mit Regionalität Geld verdienen
Regionalität sei mittlerweile zu einem Megatrend geworden. Über den Einstieg von Edeka seien längst auch die andere wie Rewe oder Real und selbst die Discounter nachgezogen. Gerade Rewe setze heute ganz stark auf Regionalität. "Wenn Sie mir vor 15 Jahren gesagt hätten, dass Rewe einmal Plakatwerbung mit einem Bild von mir macht, hätte ich Sie für verrückt erklärt. Aber so weit sind wir heute", freut sich Hönig. Die 08-Gruppe konnte über die Verpackung mit dem Ländercode ihren Trumpf immer mehr ausspielen. "Das Geld aus der Rückvergütung haben wir in die Werbung gesteckt und so wurden die heimischen Eier immer bekannter", so Hönig. Und: "Wir sind keine Kooperation mit einem Vertrag, sondern wir sind ein Verein, die Werbegemeinschaft 08-Eier aus Baden-Württemberg." Heute beläuft sich das Marketing-Budget der 42 Betriebe auf 200.000 Euro pro Jahr. Die Betriebe sind auf ganz Baden-Württemberg verteilt, in der Summe halten sie über eine Million Hühner. So halte die 08-Gruppe heute rund 30 bis 40 Prozent Marktanteil aller Eier aus Baden-Württemberg.
Erfahrungen mit dem LEH
"Der Run auf hochwertige Eier aus Freilandhaltung und/oder Bioeier war noch nie so hoch wie die letzten beiden Jahre. Hier sehe ich eine Chance für uns alle", so Hönig. Denn dies gelte auch für viele andere Produktgruppen. Die Zusammenarbeit mit dem LEH beschreibt Hönig als extrem anstrengend: „In dem Moment, in dem Sie es schaffen, ein Produkt zu kreieren, was kein anderer hat, haben Sie die Chance auf Augenhöhe zu verhandeln. Dann fängt es an, Spaß zu machen.“ Dazu brauche man aber einen langen Atem. Manche Punkte müsse man mit genügend Sitzfleisch regelrecht aussitzen. „Da kann es sein, dass sich Verhandlungen wegen einem Zehntel Cent über Monate lang hinziehen,“ meint Hönig und verrät: „Wir spielen am Ende Alles oder Nichts. Bis dato haben wir immer gewonnen".
Knallharter Preiskampf
Das Maß aller Dinge in Deutschland ist Aldi, sagt Hönig. Das gelte auch für die Eier. "Wir bekommen vom LEH jedes Jahr im Juni oder Juli die Ausschreibungen für das nächste Jahr und dürfen unsere Preise abgeben", so Hönig. Dann komme der Gegenvorschlag vom LEH, mit einem Preis, mit dem versucht werde, die einzelnen Packstellen für Eier gegeneinander auszuspielen. Da habe man als einzelner Anbieter keine Chance, weil man es hier im Grunde mit einem Oligopol zu tun habe. „Was wir früh erkannt haben, ist die Tatsache, dass wenn wir uns zusammentun, bedingt durch den niedrigen Selbstversorgungsgrad in Baden-Württemberg, es für den LEH keine Chance gibt, uns auseinander zu dividieren und die Eier einfach woanders zu kaufen.“ Rechtlich sei so ein Zusammenschluss nach EU-Recht erlaubt, ja sogar erwünscht. Deshalb hat man in Baden-Württemberg die Erzeugerorganisation gegründet, deren Sprecher Christoph Hönig ist. So sei es zum Beispiel gelungen, für das regionale Bodenhaltungsei 1,5 bis sogar 2 Cent mehr heraus zu handeln als in Bayern, wo man sich gegenseitig das Wasser abgegraben hätte.
Angebot noch besser bündeln
Hönig wünscht sich, dass die Landwirte, so wie sie mit ihren Schleppern nach Berlin fahren und politisch Druck machen, gleichermaßen fest und standhaft auch am Markt zusammenstehen. "Dann würden wir viel weiterkommen", so Hönig. Was derzeit vielfach fehlt, sei das klare Ziel: Wo möchte ich mit meinem Betrieb in fünf Jahren stehen? Wie stark schließen wir uns in Marktfragen zusammen? Warum bündeln wir unser Angebot nicht besser? Welche Ideen haben wir für die Zukunft? Hönig hofft, dass die Schlepperdemos einen Stein ins Rollen bringen, um die Perspektiven für die Bauern zu verbessern. „Auch wir Landwirte haben ein Anrecht auf Mindestlohn!“, so Hönig.
Neue Produkte und Innovationen
Um am Markt langfristig erfolgreich zu sein, müsse sich die 08-er Gruppe immer wieder Neues einfallen lassen, sonst seien die höheren Preise nicht zu halten. In der Werbung habe man zum Beispiel eine App entwickelt, mit einem Lied fürs Eierkochen. Bekannt gemacht, werden diese Botschaften meist über die Eierschachteln. In der Gemeinschaft gibt es mittlerweile drei gläserne Hühnerstalle, der erste entstand 2008. Hier würden Führungen veranstaltet, auch die Einkäufer vom LEH könnten sich von der Produktqualität überzeugen. "Wir haben Lehrtafeln in ganz Baden-Württemberg aufgestellt. Hier wird alles über Hühnerhaltung erzählt. Es gibt Erklärfilme im Internet. Diese vielen Aktivitäten schaffen Sie nur in der Gemeinschaft", so Hönig. Auch die GVO-Freiheit habe man als Gemeinschaft schon ziemlich früh vorangebracht und den heimischen Sojaanbau im Land unterstützt.
Loser Eierverkauf nimmt zu
Hönig habe bereits vor neun Jahren eine Mehrweg-Eier-Box entwickelt, die so genannte Meibox, und damit schon die Zeichen der Zeit erkannt. Damit lässt Verpackungsmüll sparen und der Eierverkauf nochmals deutlich erhöht. "Mittlerweile machen wir in vielen Supermärkten 20 Prozent des Eierumsatzes lose in diesen Obst- und Gemüseabteilung. Das hat dem Absatz einen regelrechten Schub verliehen", so Hönig. Die Kunststoffboxen seien europaweit in Gebrauch. Allein 2019 habe Hönig davon 400.000 Stück verkauft, insgesamt sind es 1,8 Millionen in Europa. Der Clou an der Box sei, dass sich innendrin ein patentierter Einsatz zum Eierkochen befände, mit dem sich das Ei direkt im Wasserkocher energiesparend kochen lässt.
Bio-Eier sind knapp - aber der Markt muss auch aufnahmefähig bleiben
Insgesamt hätten sich alle Betriebe in der 08er-Gruppe gut entwickelt. "Wir bauen aber erst einen neuen Stall, wenn wir den Markt haben", so Hönig. Der Grund: "Du musst nicht verkaufen müssen. Wenn das der Fall ist, hast du ein Problem." Vor allem bei den Bio-Eiern laufe man in Baden-Württemberg dem Markt seit Jahren hinterher und könne nicht genügend Eier liefern. "Aber das stört mich nicht. Für die Preisverhandlungen ist das gut so. Da bin ich - der liefernde Hönig - sozusagen der König."






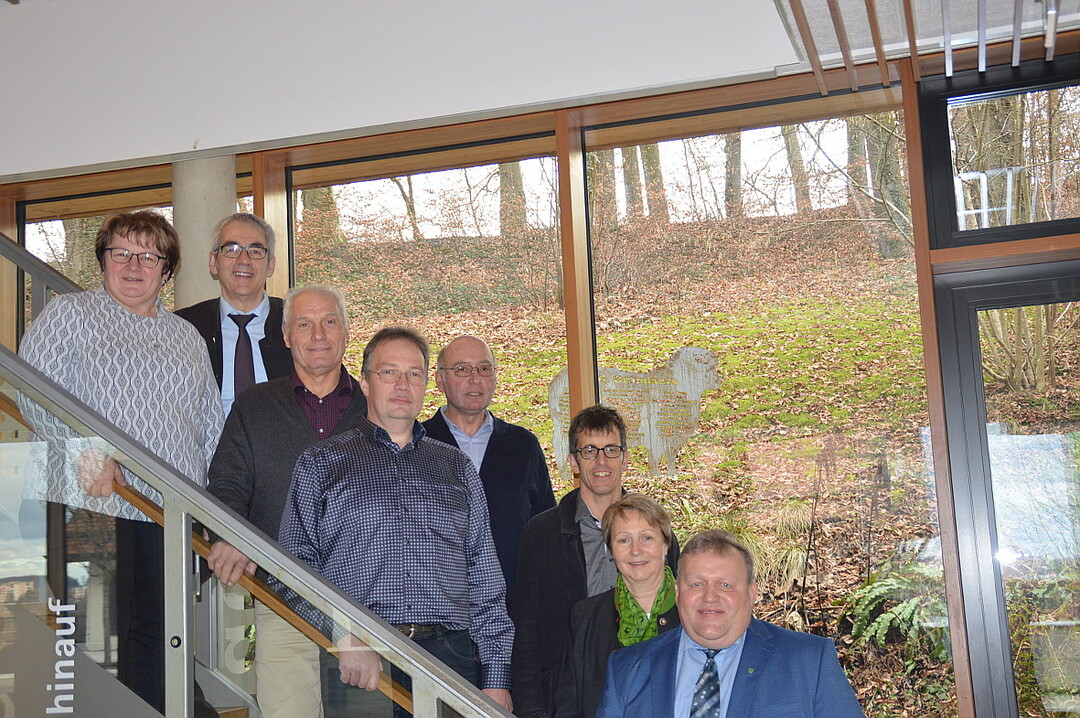



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.