Fotovoltaik: Mit und für die Landwirtschaft
Aus Sonnenlicht Strom zu produzieren, um ihn zu verkaufen oder selbst zu nutzen: Das treibt derzeit viele Betriebe um. Doch welche Anlagen und Geräte lohnen sich? Wie soll man einsteigen, wie weitermachen? Wo liegen die Fallstricke und welche Chancen gibt es? Jede Menge Frage zur Fotovoltaiknutzung in der Landwirtschaft, die am 9. März in Leutkirch diskutiert wurden. Die Gesprächsleitung des Abends hatte Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben.
- Veröffentlicht am

Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg sprach über die Energiepreisbremse, über Abnahmemodalitäten und über gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel die Fotovoltaikanlagenpflicht oder die Mehrwertsteuerbefreiung für Anlagen bis 30 kW. Seit vergangenem Jahr gibt es nicht nur die Überschusseinspeisung, sondern auch die Verpflichtung zur Volleinspeisung, mit jeweils unterschiedlichen Vergütungssätzen. Im Kommen ist der sogenannte Smart Meter als intelligente Messeinrichtung, der gerade auch bei der Umrüstung von Altanlagen interessant ist. In den vergangenen Jahren seien rund 20.000 Kleinanlagen aus der Vergütung gefallen, diese Anlagen sollte man weiter betreiben und bei Bedarf umrüsten. Vergütet wird der mit den Altanlagen erzeugte Strom immerhin dem durchschnittlichen Preis, der an der Börse ermittelt wurde. Insgesamt wird die Eigennutzung des PV-Stroms für die Heizung und über die Batteriespeicher immer wichtiger.
Speicher für Haus und Hof
Jens Häberle ist im Vorstand der Battr-Energy AG aus Kraftisried im Allgäu. Der Entwicklungsingenieur baut mit seiner Firma Batteriespeichersysteme, die er aus gebrauchten beziehungsweise aussortierten Elektrofahrzeugbatterien so umwandelt, dass damit ökologisch erzeugter Strom aus Fotovoltaik gespeichert werden kann. So entstehen vielversprechende Speichersysteme für Haus und Hof. „Bis ein Fahrzeug in Serie geht, werden bei der Entwicklung bis zu 1000 Batterien mit um die 80 Kilowattstunden benötigt. Batterien werden verschrottet, die rein elektrisch gesehen quasi noch neu sind“, berichtet der gelernte Fahrzeugbauer. Auf der anderen Seite brauche man dringend Speicher für die Erneuerbaren. Die Speicher, die Häberle aus den E-Auto-Batterien herstellt, seien so groß, dass sie gerade in der Landwirtschaft großen Sinn machten. Gut geeignet sei so eine rund 8000 Euro teure Batterie für den Außenbereich, sie wird mit acht Schrauben an die Außenfassade montiert, ist wasserdicht und bleibt auch bei bis minus 30 Grad noch funktionsfähig. Mit der Firma habe sich Häberle auf Landwirtschaft spezialisiert, auf 15 landwirtschaftlichen Betrieben seien derzeit Testanlagen am Laufen. So eine Batterie-Anlage hat 32 Kilowattstunden nutzbare Energie und kann auf 100 Kilowattstunden hochgefahren werden.
Partner in der Region
Gabriel Frittrang ist Manager bei der 2009 gegründeten Firma Solmotion Project GmbH aus Ravensburg, die jüngst mit dem Wirtschaftspreis der Stadt Ravensburg ausgezeichnet wurde. Frittrang hilft nach eigenen Angaben Landwirten PV-Anlagen zu planen, zu bauen und dann auch später zu unterhalten. Aktuell habe die Firma rund 100 Projekte in der Planung. Anlagen auf Freilandflächen böten das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Man habe damit langfristig die besten Erträge und am wenigsten Wartungsaufwand, betont der Manager. Als Flächen kämen am ehesten welche in Frage, die landwirtschaftlich nur bedingt genutzt werden (ertragsschwache oder benachteiligte Flächen, Wasserschutzgebiete oder in privilegierten Zonen an Schienen und Autobahnen). Eine Agri-PV sei grundsätzlich immer teurer als eine reine Freiflächenanlage, umso wichtiger sei es, dass die Agri-PV-Anlage auch ihr Geld erwirtschaftet.
Hoher Planungsaufwand
Wegen dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist der Aufwand für die Freiflächenanlagen auf jeden Fall bislang noch erheblich. „Jeder will mitreden“, so Frittrang. Neben dem Flächennutzungsplan muss auch der Regionalplan beachtet werden. „Wir bewegen uns in einem rechtlichen Rahmen, der sich ständig ändert“, beschreibt Frittrang die Lage. Seiner Einschätzung nach dürften auch die meisten Kommunen bei der Planung von Solarparks überfordert sein. „Wir begleiten solche Prozesse“, so Frittrang. Einer seiner Kunden war auch der Obstbauer Hubert Bernhard aus Kressbronn. Er zählt mit seiner Agri-PV-Anlage am See zu den Pionieren in Sachen Agri-PV und gibt seine Erfahrungen gerne an die Kollegen und Kolleginnen weiter. „Wir hatten im vergangenen Jahr über 1500 Besucher, die unsere Anlage besichtigt haben“, zeigte sich Bernhard optimistisch, dass der Ausbau von Agri-PV in den nächsten Jahren weitervorangeht.
Agri-PV-Projekt in Schlier geplant
Das hofft auch Severin Batzill. Der Milchviehhalter vom Fohrenhof aus Schlier unweit von Ravensburg milkt 140 Milchkühe in einer GbR. Batzill plant drei eigene Agri-PV-Anlagen mit Einachs-Tackern. Dabei handelt es sich um horizontale, einachsige, kippbare Fotovoltaiktische in einer Reihe. Die Drehachsenhöhe liegt bei 2,80 Meter. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt elf Meter, neun Meter davon stehen für den normalen Ackerbau zur Verfügung. Die Randflächen, die an die Modultische angrenzen sollen Blühstreifen werden. Unterm Strich bleiben so anhand dieser Doppelnutzung 85 Prozent der Fläche für die Landwirtschaft, die anderen 15 Prozent werden zur Energiegewinnung genutzt. Durch diesen Eingriff in die Natur allerdings mussten trotz Doppelnutzung Ökopunkte an anderer Stelle kreiert werden. So haben die Batzills an anderer Stelle ihre Streuobstbestände ergänzt und wollen die Anlage eingegrünen, um so an die Ökopunkte zu kommen.
Mehr Stromertrag
„Wir wollten eine Anlage, die morgens und abends die höchsten Erlöse erwirtschaftet, das war mit diesem der Sonne nachgeführten Anlagenkonzept möglich“, so Batzill. Und: „So haben wir 30 Prozent mehr Stromertrag pro installiertem Kilowattpeak (kWp) von der Fläche im Vergleich zu feststehenden bi-facialen Ständern. Anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang sind wir bei 90 Grad Einstrahlwinkel. Die Software steht noch nicht, aber die machen wir selbst. Wenn der Strompreis bei null Cent ist, kann ich die Tische so drehen, dass die Sonne voll der Kultur zugutekommt“, meinte Batzill.
So lief die Flächenauswahl - Batzill betritt Neuland
Baurechtlich habe der Gemeinderat bereits grünes Licht erteilt, und da solche Anlagen im deutschsprachigen Raum noch selten seien, mussten viele Ideen und Pläne selbst erarbeitet werden, weil selbst die Hersteller von Modulnachführungen keine oder nur wenig Erfahrungen damit haben, so Batzill. Bei der Flächenauswahl war wichtig, dass Anschlussleitungen in der Nähe sind. Anwohner sollten sich nicht gestört fühlen, ebenso wenig die Natur. Weil es keine eigenen Flächen gab, die all diesen Kriterien standhielten, mussten Flächen angeworben werden. "Wir sind auf fünf Eigentümer und Pächter zugegangen, zwei waren sofort dabei. Weitere Eigentümer kamen auf uns zu und so sind wir auf die drei Standorte gekommen", so Batzill. Initiatoren sind er und sein Bruder Merlin Batzill. „Bei dem einen Standort sind wir zu zweit, an einem weiteren Standort sind wir zu viert, mein Bruder und ich sowie die beiden Brüder, denen die Fläche gehört und am dritten Standort ist noch ein Freund von uns beteiligt, weil dem die Fläche auch gehört. Insgesamt sind wir also zu fünft, wobei mein Bruder und ich an allen Standorten beteiligt sind und die anderen jeweils an einer Anlage“, erläutert Batzill auf Anfrage von BWagrar die Beteiligungen. Zudem habe die Gemeinde Fläche mit eingebracht und der Pachtvertrag sei so geschrieben, dass sich die Höhe der Pacht mit nach dem "Marktwert Solar" richtet und dadurch an die Inflation angepasst ist.
Wasserdichte Verträge gefragt
Ziel der Landwirte müsse es sein, den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten. Die Investitionssumme sei immens: pro Hektar müsse man bis zu einer Million Euro einplanen. Die Verträge müssten alle top vorbereitet sein, sonst gebe es von den Banken keinen Kredit. Wichtig sei eine "saubere" Beratung und eine bestmögliche Abstimmung des Konzeptes auf den Betrieb, wie es bei Hubert Bernhard der Fall gewesen ist. "Agri-PV mit Obst oder mit Acker: das ist etwas komplett anderes als eine normale Dachanlage", meint Batzill. Die standardisierte Vorgehensweise wie Netzanfrage, Angebote einholen für Module, Wechselrichter und Trafostation, dass alles ist bei einer Agri-PV-Anlage das geringste Problem. Hier sei im Vorfeld extrem viel Planungsarbeit erforderlich und es gebe wenig Erfahrungswerte. Und wer beim Stromverkauf außerhalb vom EEG agieren will, brauche einen langfristigen Stromabnahmevertrag, sonst gebe es keine Kredit.
Vorsicht Erbschaftssteuer
Das Baurecht, das Steuerrecht und die Direktzahlungen sind die Themen, die Batzill beschäftigen. Bei der Flächenauswahl, aber auch steuerlich habe AgriPV deutliche Vorteile gegenüber Freiflächen-PV-Anlagen. Wer zum Beispiel eine Fläche von 10 Hektar für eine Frei-Flächen-Anlage verpachtet, muss bei der Betriebsübergabe kräftig Steuern zahlen. Weil die Fläche mit der Anlage nicht mehr als landwirtschaftliche sondern als Gewerbefläche eingestuft wird, bei einer Agri-PV-Anlage ist das nicht der Fall. Ähnlich verhält es sich bei der Grundsteuer aus. Deswegen rät Batzill: "Holen Sie sich einen guten Steuerberater mit ins Boot."
Großer Zubau von Fotovoltaik geplant
Ziel der Bundesregierung ist ein Zubau von Fotovoltaik von 22 Gigawatt pro Jahr. Umgerechnet in Freiflächen-PV wären das 22.000 ha Fläche. Die Gemeinden müssen zwei Prozent der Flächen für erneuerbare ausweisen und davon 0,2 Prozent für PV, meinte Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben. „Wir haben jetzt noch die Chance, mit dabei zu sein als Umsetzer und als Investor. Wir müssen mitentscheiden, welche Flächen entbehrlich sind und welche Flächen sich technisch eignen. Denn letztlich hat für uns Landwirte die Lebensmittelerzeugung oberste Priorität“, so Schönberger.
Hoher Bedarf an Energie
Laut Raimund Haser (MdL, CDU) und umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten beträgt derzeit der Stromverbrauch in Baden-Württemberg 65 bis 70 Terawattstunde. Produziert werden mit Neckarwestheim 42 Terawattstunden, ohne sind es nur 32. „Aus den 70, die wir heute verbrauchen, könnten die nächsten Jahre 90 werden“, schätzt Haser. Das heißt: „Jede Kilowattsunde, die Sie produzieren, wird gebraucht. Die Netzbetreiber kaufen Ihnen jede Kilowattstunde Strom ab“, ist Haser überzeugt, der wie er selbst sagt dagegen gewesen war, dass man PV in den Regionalplan mit reinnimmt, weil der Markt sehr dynamisch sei. Aber nun müssten 0,2 Prozent der Fläche für Fotovoltaik eingeplant werden, bestätigte Haser, 1,8 Prozent soll für Wind ausgewiesen werden. Hinzu kommen 200 Meter-Streifen entlang der Autobahnen, wobei der Abstand zur Autobahn 50 Meter betragen soll.
Fotovoltaik in Bauernhand
„Wir dürfen das Geschäft nicht irgendjemandem überlassen. Derzeit sind viele Glücksritter unterwegs – Projektierer, die klingeln an der Tür und fragen nach Flächen“, warnte Haser. Umso dringlicher sei es, selbst Projekte auf die Beine zu stellen. „So bleiben Sie Herr auf dem eigenen Hof. Nehmen Sie Berufskollegen, Freunde oder Firmen aus der Region mit ins Boot“, forderte Haser. Wichtig sei, dass sich auch kleinere Anlagen bis 1 Megawatt in der Freifläche realisieren lassen. „Das ist unser Land, unser Geld und unser Verdienst“, so Haser. Grundsätzlich sei es höchstproblematisch mit Fotovoltaik noch mehr in die Fläche zu gehen. Einziger Grund hierfür sei der Preis. Haser kritisierte scharf, dass selbst auf den Dachflächen der landeseigenen Gebäude immer noch viel zu wenig Fotovoltaik installiert ist. Gerade bei den Dachflächen gebe es landauf landab noch ein erhebliches Ausbaupotenzial.








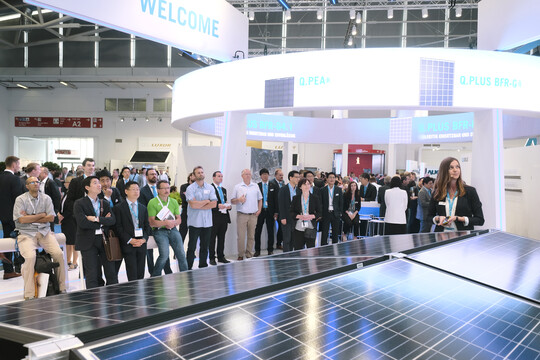

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.