Der Frost hat Obst und Wein voll erwischt
Die tiefen Minustemperaturen der Frostnächte vom 19. bis 21. April haben dem Obst- und Weinbau massiv zugesetzt und auch Ackerkulturen geschädigt. Braune Blüten und Samenanlagen beim Baumobst, erfrorene Austriebe an den Rebstöcken und hochgefrorene Zuckerrübenpflänzchen lassen die Ertragsaussichten schwinden. Auch wenn der Schaden noch nicht exakt zu beziffern ist, eines ist sicher: Er geht in die Millionen.
- Veröffentlicht am

Man mag es einfach immer noch nicht glauben, dass so viele Blüten erfroren sind“, sagt Daniel Strohmaier, während er ein um die andere Blüte in seiner Apfelanlage am Ortsrand von Kressbronn im Bodenseekreis öffnet. Mit einem frustrierenden Ergebnis: Fast alle sind innen braun, selbst die sich zwischenzeitlich zeigenden Nachblüher. Der Frost hat ganze Arbeit geleistet. „Viel zu ernten wird es nicht mehr geben“, meint er entmutigt, auch wenn er von einem Totalausfall zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig sprechen will.
Frostereignisse hatte der 45-jährige Obstbauer schon oft erlebt, an ein solches Ausmaß aber kann er sich nicht erinnern. „Natürlich hatte ich ein mulmiges Gefühl, als die Frostnächte angekündigt waren“, erzählt er, dennoch aber darauf gehofft, dass es so schlimm schon nicht werde. Einen gehörigen Schrecken versetzte ihm dann aber das Bild, das seine Anlagen am Donnerstag früh boten. „Schon von Weitem zeigte sich, dass die Bäume das Laub hängen ließen“, berichtet er über die Folgen der ersten Frostnacht, die die Temperaturskala auf minus vier Grad absacken ließ.
Im zweiten Jahr keine Ernte
Getroffen hat es alle Kulturen des Betriebes. Das sind neben 13 Hektar Kern- und Steinobst auch drei Hektar Wein sowie die Christbaumanlage, bei der es die empfindlichen Neutriebe erwischt hat. Dabei kommt es für Strohmaier knüppeldick, denn bereits im letzten Jahr hatte er nach einem starken Hagelschaden kaum Äpfel. „Finanziell wird es nun richtig schwierig“, blickt er sorgenvoll in die Zukunft. Die Hoffnung mag er noch nicht ganz aufgeben und knüpft sie an den Weinbau, wo die Schäden nicht ganz so drastisch sind und an extrem stark blühende Anlagen, wo vielleicht der eine oder andere Apfel im Herbst doch noch am Baum hängt. „Jonagold wird es aber keine geben, denn die haben nur ganz verhalten geblüht“, ist er sich sicher.
Das Extremfrostereignis mit Temperaturen von bis zu minus sechs Grad führt in allen Anbauregionen des Landes zu massiven Schäden. Die Apfelbäume wurden in der Vollblüte und damit in der empfindlichsten Phase getroffen. Noch schlimmer sieht es im Steinobst aus. Die Kirschenernte wird nahezu komplett ausfallen, denn selbst ein Anbau unter Foliendach bot den kleinen Früchten keinen ausreichenden Schutz.
„Es gibt keinen Betrieb, der nicht über Schäden klagt“, stellt Kathrin Walter, Geschäftsführerin des Landesverbandes Erwerbsobstbau, nach einer ersten Rundfrage in den Anbauregionen des Landes fest. Auch sind innerhalb eines Gebietes alle Lagen gleichermaßen betroffen. „Dieses Mal machte es am Bodensee keinen Unterschied, ob die Apfelbäume in Weinbaulagen stehen oder in einem Kälteloch“, meint Werner Baumann, wobei der Obstbauberater im Bodenseekreis darauf verweist, dass die Ursache der verheerenden Schäden an den Blüten kein Strahlungsfrost, sondern kalte Polarluft in Verbindung mit Wind war. Dies war auch der Grund, weshalb beispielsweise Frostschutzkerzen keinen Erfolg brachten. „Der Wind hat die erwärmte Luft sofort wieder weggeblasen“, erklärt er. Wirklich hilfreich ist einzig und allein die Frostschutzberegnung. Die aber ist am Bodensee nur auf rund hundert Hektar im Raum Oberdorf bei Langenargen möglich. „In beregneten Anlagen habe ich keine schwarzen Samenanlagen gefunden und ein intensiver Bienenflug zeigt, dass die Blüten dort intakt sind“, hat Baumann zu Wochenbeginn beobachtet.
Hoffnung ruht auf Nachblühern
Sicher ist, dass es eine schlechte Baumobsternte geben wird. Eine seriöse Angabe zur Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht möglich, auch wenn sich der Anteil an erfrorenen Blüten- und Samenanlagen enorm ausnimmt. „Bei einem fünfstündigen Rundgang durch Obstanlagen am See habe ich nach der zweiten Frostnacht kaum noch intakte Blüten gefunden“, lautet die ernüchternde Bilanz von Klaus Altherr, Obstbauberater bei der Württembergischen Obstgenossenschaft (WOG) in Ravensburg. Dennoch will er nicht ganz schwarzsehen, denn selbst bei einem hohen Anteil geschädigter Blüten gibt es noch Äpfel an den Bäumen. So können sich am einjährigen Holz jetzt noch Blüten entwickeln. Allerdings wachsen die sich daraus entwickelnden Früchte meist nicht in der gewünschten Topqualität heran. Ferner bleibt abzuwarten, ob die nicht geschädigten Blüten tatsächlich Früchte im Herbst liefern oder ob ein Teil nicht noch beim Junifruchtfall verloren geht.
Ähnlich beurteilt auch Michael Zoth vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Bavendorf die Lage. Nach exakten Auszählungen an verschiedenen Sorten ergab sich ein Anteil von sechs bis 19 Prozent noch intakter Samenanlagen. „Bei Golden Delici-ous und Pinova sieht es schlecht aus, bei Gala, Elstar und Fuji ist es besser als am Freitag nach den beiden Frostnächten zunächst befürchtet“, meint er. Der Großteil intakter Blüten stammt allerdings aus den Lateralblüten, was die bereits erwähnten Abstriche bei der Qualität befürchten lässt. Eines aber scheint sich immer deutlicher abzuzeichnen: Voll getroffen hat es wieder einmal die empfindliche Sorte Jonagold, die nach wie vor die Brotsorte am Bodensee ist.
Erdbeeren und Spargel
Besser sieht es bei Erdbeeren aus. Wie der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mitteilt, konnte in den typischen Anbaugebieten im Südwesten ein Totalausfall der frühen Erdbeersätze dank Tunnel, Vlies und Frostschutzberegnung verhindert werden. In Regionen, die von Temperaturen unter minus fünf Grad betroffen und in denen keine Schutzmaßnahmen mehr möglich waren, sind die frühen Sorte verloren. Fehlende Schutzmaßnahmen kamen vor allem dadurch zustande, dass in vielen Märkten Vliese kurzfristig restlos ausverkauft waren.
Bei Temperaturen um minus zwei Grad ohne Schutzmaßnahmen sind höchstwahrscheinlich die offenen Blüten, aber nicht die Knospen betroffen, sodass eine reduzierte Ernte womöglich noch denkbar ist. In Spargel sind vor allem Junganlagen und Grünspargel betroffen. In Bleichspargel ist maximal eine Tagesernte in Mitleidenschaft gezogen und das vor allem an den Stellen, wo Spitzen aus der Erde ragten und die Folien berührten. Der Schaden hier ist damit begrenzt.
Die erste Frostnacht hat auch die Weinberge kalt erwischt. Alle Winzer wussten um die kommende Eiseskälte. Doch nur wer beregnen konnte, war einigermaßen sicher vor Frostschäden, berichten Weinbauberater aus den Regionen Württemberg und Franken. Selbst einige Tage nach den Frostnächten bleiben die Berater vorsichtig in ihren Schadenschätzungen. Lothar Neumann rechnet für das nördliche Württemberg „mit einem enormen Gesamtschaden“. Der Weinbauberater des Landratsamts Heilbronn erwartet, dass „im Gebiet im Schnitt 60 Prozent aller Hauptaugen erfroren sind“. Die Knospen eines Rebstocks werden als Augen bezeichnet. Einzelbetrieblich gesehen reiche die Schadenspanne von null bis Totalschaden. Laut Neumann war der Frost am Morgen des 20. April der folgenreichste. Alle späteren Frostnächte brachten bis Redaktionsschluss keine zusätzlichen Ausfälle. Bemerkenswert: In den beiden Frostnächten wurden auch vermeintlich frostsichere Lagen heimgesucht.
Erfrorene Augen an Reben
Den Grund sieht Siegfried Hundinger vom Landratsamt Ludwigsburg „im kalten Nordostwind mit polarer Kaltluft“, der mit bis minus sieben Grad den Reben zusetzte. Hundinger schätzt die Zahl erfrorener Augen auf 70 bis 75 Prozent. Bei solchen Temperaturen „helfen weder Hubschrauber noch Frostkerzen“. Wer beregnen konnte, war besser dran. Die Erstarrungswärme bringt laut Hundinger einen Temperaturgewinn von vier bis fünf Grad.
Die befragten Berater sind sich einig, dass die Folgen des Frosts für den Ertrag noch kaum zu schätzen sind. Dazu sei die Regenerationsfähigkeit der Rebe zu komplex. Roland Zipf will die weitere Entwicklung der Reben abwarten. „Um über die Regeneration zu reden, ist es noch zu früh“, sagt der Weinbauexperte des Landratsamts Bad Mergentheim.
Arthur Baumann vom Weinbauring Franken rechnet bis Anfang Mai nicht mit nennenswertem Wachstum der Reben. Solange die Temperaturen „so kühlschrankmäßig sind“, komme der Austrieb kaum voran. Laut Baumann lagen die tiefsten Temperaturen in Franken bei minus sechs Grad. Teils verursachte der Frost starke Schäden. Dennoch will er über Ertragsausfälle nicht spekulieren.
Der Hubschrauber-Versuch des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums zusammen mit dem Weinbauverband Württemberg brachte gemischte Ergebnisse. Das Fazit: Lediglich bei Temperaturen zwischen null und minus drei Grad sei die Maßnahme hilfreich, wie es beispielsweise im Kochertal im Nordwesten des Landes der Fall war. Aufgrund der massiven Kaltluftfront und der Minustemperaturen von teils minus sieben Grad brachte der Einsatz insgesamt keinen durchschlagenden Erfolg und wurde deshalb, bis auf das Kochertal, in der zweiten Frostnacht nicht wiederholt.
Mais
Bei aufgelaufenem Mais haben die Nachtfröste von bis zu minus sechs Grad in Südbaden zu starken Schäden geführt. Betroffen sind in erster Linie Frühsaaten, die Ende März und Anfang April gesät wurden und zum Zeitpunkt der Fröste bereits zwei bis drei Blätter hatten. Die späteren Saaten, die noch nicht oder nur im Keimblattstadium aufgelaufen waren, dürften laut Hubert Sprich von der ZG Raiffeisen keinen wesentlichen Schaden genommen haben. Stark betroffen sind circa 500 Hektar, wovon die ersten Flächen bereits umgebrochen wurden und in den nächsten Tagen erneut gesät werden müssen.
Hochgefrorene Zuckerrüben
Auch die Zuckerrüben wurden von den starken Frösten in vielen Regionen Baden-Württembergs zum Teil massiv geschädigt. Bis minus acht Grad setzten den Pflanzen zu. Im östlichen Rübenanbaugebiet, das dem Werk Rain am Lech zugeordnet ist, hat der Frost (bis minus elf Grad) zu Ausfällen in größerem Umfang geführt: Der Boden war bis zu drei Zentimeter tief gefroren. Als Folge hatte sich laut Harald Wetzler, Geschäftsführer des Verbands baden-württembergischer Zuckerrübenanbauer, die obere Bodenschicht angehoben und die Rüben wurden regelrecht abgerissen. Die Umbruchfläche in dieser Region beträgt rund 50 Hektar (Stand Redaktionsschluss). Im Offenauer Einzugsgebiet hielten sich die Schäden dagegen in Grenzen, frostbedingte Ausfälle blieben weitgehend aus.
Kartoffeln: Wachstumsvorsprung dahin
Die Entwicklung der Frühkartoffeln hatte bis zum Frost einen Vorsprung von bis zu zehn Tagen im Vergleich zu den Vorjahren. Mark Mitschke vom Beratungsdienst Kartoffelanbau Heilbronn rechnet damit, dass der Anbau von einem frühen Erntezeitpunkt auf einen gewöhnlichen Termin zurechtgestutzt wurde. Die erwarteten Erträge liegen nun auf einem Normalniveau unter erschwerten Bedingungen. Die erste Ernte für den Privatmarkt könnte jetzt zwischen dem 10. und 20. Mai starten. Blattschäden durch die niedrigen Temperaturen sind klar sichtbar: Verluste von zehn bis 15 Prozent sind realistisch, ungeschützte Bestände haben ihre Ertragsspitzen verloren. Zehn Tage durch die Verzögerung haben Anbauer nun zum Päppeln der Pflanzen.
Die Situation kann laut Ulrich Bernhard, Vorsitzender des baden-württembergischen Erzeugerverbands, aber noch marktgerecht werden. Dem Handel passen die zehn Tage Verzögerung zumindest gut. In abgedeckten und frostberegneten Beständen kann die Ernte zum Teil sogar vor dem 10. Mai beginnen. Ein Zweierintervall bei der Beregnung hat gegen die langen Nachtfröste geholfen, bei einem Dreierintervall waren die Pausen zu groß. Alles in allem waren die Frühkartoffelanbauer mit Zugang zu einer Frostschutz-Bewässerung gut vorbereitet.






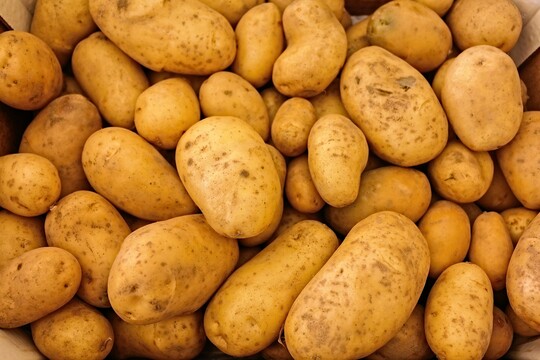





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.