
Pionierarbeit mit Robotern
Für mehr Diversifizierung auf dem Acker müssen digitale Technologien weiterentwickelt werden. Überdies sollte die Wissenschaft enger mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Zwei von vielen Schlussfolgerungen, die Projektkoordinatorin Dr. Kathrin Grahmann vom ZALF Müncheberg/Brandenburg aus den ersten fünf Jahren des patchCROP-Projektes zieht.
von Interview: Susanne Gnauk erschienen am 19.06.2024Studien und mehr Informationen zum patchCROP-Projekt im Netz.




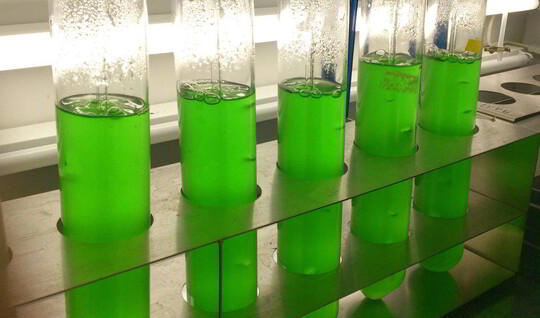





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.