Nachhaltigkeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit
- Veröffentlicht am

Nach dem zweiten Weltkrieg sollten die Beschäftigten in der Landwirtschaft besser informiert und der Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln gesteigert werden, blickt Georg Heitlinger auf die Gründe zurück, den „Verband landwirtschaftlicher Geflügelhalter“ ins Leben zu rufen. Diese Anliegen sind immer noch aktuell, betont der erste Vorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbandes Baden-Württemberg. Geflügel stünde mehr im Fokus als andere Tierarten. Nach Käfigverbot und der Forderung nach niedrigeren Besatzdichten stünden die Geflügelhalter derzeit vor der Notwendigkeit der Bruderhahnaufzucht und vor steigendenden Produktionskosten, wies Heitlinger auf die aktuellen Herausforderungen in der Geflügelhaltung hin. Viele Betriebe stünden mit dem Rücken zur Wand.
Ansprüche an die Landwirtschaft steigen
Die Schwierigkeiten in der Landwirtschaft, so Dr. Konrad Rühl vom baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium, seien unter anderem geprägt durch die problematische Marktsituation mit einem Selbstversorgungsgrad von etwa 30 Prozent und den hohen Ansprüchen der Gesellschaft an die Tierhaltung. „Wir brauchen pragmatische Lösungen beim Baurecht und Verlässlichkeit bei den Tierwohlstandards,“ forderte er. Er lobte den optimistischen Blick des Verbandes in die Zukunft, der auch in der Jubiläumsbroschüre zum Ausdruck kommt, und schloss mit der Feststellung, nachhaltige Landwirtschaft sei eine Landwirtschaft, die der Gesellschaft gefallen würde.
Weniger Geflügelbetriebe in Baden-Württemberg mit QS-Zeichen
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Nutzer des QS-Qualitätszeichens leicht zurückgegangen, erklärte die Geschäftsführerin des GWV BW Helga Futterknecht. 2021 nahmen mit 61 Betrieben fünf weniger teil als im Vorjahr. Die Zahl der Legehennenplätze stieg jedoch leicht an auf 1,44 Millionen. Es wurden 400 Millionen vermarktungsfähige Eier produziert. Die Mäster, so Futterknecht weiter, hätten oft keinen Schlachthof in der Nähe. Insgesamt 28 Betriebe im eigenen Bundesland beziehungsweise in einer Entfernung unter 120 Kilometern schlachten. Insgesamt 65 Betriebe hätten einen weiteren Weg, „da wird es mit der Transportzeit von vier Stunden schwierig“. Die Salmonellensituation im Land sei ähnlich gewesen wie in den Vorjahren, zehn Legehennenherden und zehn Putenmastherden seien betroffen gewesen. Zum Schluss ging sie noch auf die Branchenkommunikation Legehenne ein. „Der Etat für die Werbung sei groß, aber die Aktionen der IDEG hätten Erfolg, so würde zum Beispiel die Lehr- und Lernplattform „Geflügel macht Schule“ wieder neu aufgelegt.
Herausforderung: Frühe Geschlechtsbestimmung im Ei
Der Ausstieg aus dem Kükentöten wird nicht mehr rückgängig zu machen sein, ist Professor Rudolf Preisinger von der EW Group überzeugt. Daher richten sich alle Hoffnungen auf die frühe Geschlechtsbestimmung im Brutei vor dem siebten Tag. Es gebe einige marktreife Verfahren. Schmerzempfinden ab dem 13. Tag machten diese Verfahren ab 2024 unmöglich. Ein marktreifes Verfahren sei die optische Messung am 13. Bebrütungstag, dieses funktioniere jedoch nur bei Braunlegern. Weitere optische Verfahren, etwa mit Infrarot oder mit Fluoreszenzmessung, jeweils über ein Loch in der Eischale, seien vermutlich bis 2024 nicht praxisreif. Neben den optischen Verfahren gibt es verschiedene auf Basis einer Flüssigkeitsprobe. Diese kommen aber auch erst am 9.Tag zum Einsatz und dies mit einem deutlich geringeren Durchsatz. Eine Lösung seien auch Zweinutzungshühner, denn ein aufgezogener Legehennenbruder würde dreimal so viel CO2 produzieren wie ein Broiler. Hier sei die Züchtung gefordert, denn inzwischen stehe Tierwohl über Ressourcenschonung.
Mit Informationen Vertrauen beim Verbraucher schaffen
„Bilder prägen die Meinung, und Vertrauen kann ich als Verbraucher nur dem entgegenbringen, der mich informiert“, betonte Professor Matthias Michael von der Deutschen Gesellschaft für Reputationsmanagement. In den Dörfern hätten die Landwirte eine gute Reputation, durch das Öffnen ihrer Höfe sei hier der Informationsfluss gut. Jetzt sollten die Landwirte mehr in die Städte gehen. Praktika in der neunten Klasse würden zum Beispiel sehr helfen, Informationen frühzeitig zu vermitteln. Außerdem würde die Branche laut Prof. Michale nicht mehr zeitgemäß kommunizieren, „mir fehlen emotionale Auftritte mit Geschichten von und über interessante Menschen.“
Bei der Beobachtung des Verbraucherverhaltens in den vergangenen zwei Jahren zeige sich, dass mehr gespart wird, berichtetes Anne Schweickhardt vom deutschen Marktforschungsinstitut GfK: Der Verbrauch an Frischeprodukten ging zurück, es wurde mehr im Discounter und weniger im Lebensmitteleinzelhandel-Vollsortimenter gekauft. Beim Vergleich der Fleischsorten schnitt Geflügelfleisch gut ab, der Verbrauch stieg leicht an, vor allem in den jüngeren Verbrauchergruppen, Schweinefleisch wurde weniger gekauft, Rindfleisch blieb gleich. Die Verbraucher wollen Nachhaltigkeit und Tierwohl, definieren es aber nicht und setzen es oft mit „bio“ gleich. Wichtiger als biologische Erzeugung sein bei Befragungen aber die Regionalität. Bei Eiern hätten Verbraucher etwas häufiger zu Bio- oder Ökoware gegriffen, so die Ergebnisse des Instituts.
Der Lebensmitteleinzelhandel sieht sich als Partner der deutschen Landwirtschaft, betonte Robert Pudelko, verantwortlich für das Lieferantenmanagement und den Einkauf bei Kaufland. Das Unternehmen wirbt mit heimischen saisonalen Produkten, die auch entsprechend gekennzeichnet sind, so Pudelko. Im Sortiment seien 25.000 lokale Produkte von mehr als 1600 Erzeugern. Bei Geflügel soll das Angebot an frischer Ware aus Haltungsform Stufe 3 und 4 bis 2023 verdoppelt werden, bis 2026 soll jedes fünfte Geflügelprodukt aus Stufe 3 oder 4 stammen, nennt Pudelko die Ziele von Kaufland.
Chronik 75 Jahre Geflügelwirtschaftsverband
- Am 9. Juni 1947 wurden die Geflügelwirtschaftsverbände Südwürttemberg-Hohenzollern, Nordwürttemberg, Nordbaden und Südbaden mit der Unterstützung durch das Ministerium gegründet.
- 24. Juli 1947: Gründung des Geflügelwirtschaftsverbandes Südwürttemberg-Hohenzollern, (keine Belege für Nordbaden, Südbaden, Nordwürttemberg vorhanden)
- 17. Mai 1952: Zusammenschluss der vier Länder (Nordwürttemberg, Württemberg-Hohenzollern, Nordbaden, Südbaden) zu einem Bundesland mit dem Namen „Baden-Württemberg“.
- 4. April 1967: Gründung des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. als Dachverband der Geflügelwirtschaft unter Dr. Hans Kautz. Gründungsmitglied ist unter anderem Karl Magnus Graf Leutrum von Ertingen.
- 30. Juni 1967: Gründung der Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischen Tierzuchtorganisation als Voraussetzung für den Zusammenschluss der vier Landesverbände
- 9.6.1970: Zusammenschluss der vier Geflügelverbände in Baden und Württemberg
- Aus dem Geflügelwirtschaftsverband Nordbaden wird der Name in Geflügelwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V. Die drei anderen Verbände wurden aufgelöst.
- Der Geflügelwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgart startete mit 788 Mitgliedern unter dem Vorsitz von Karl Magnus Graf Leutrum und dem ersten Geschäftsführer Hans-Dieter Wetschky.
- Die Mitgliederzahl stieg bis zum 30.6.1973 auf den Höchststand von 963. Heute sind es 385 Mitglieder.

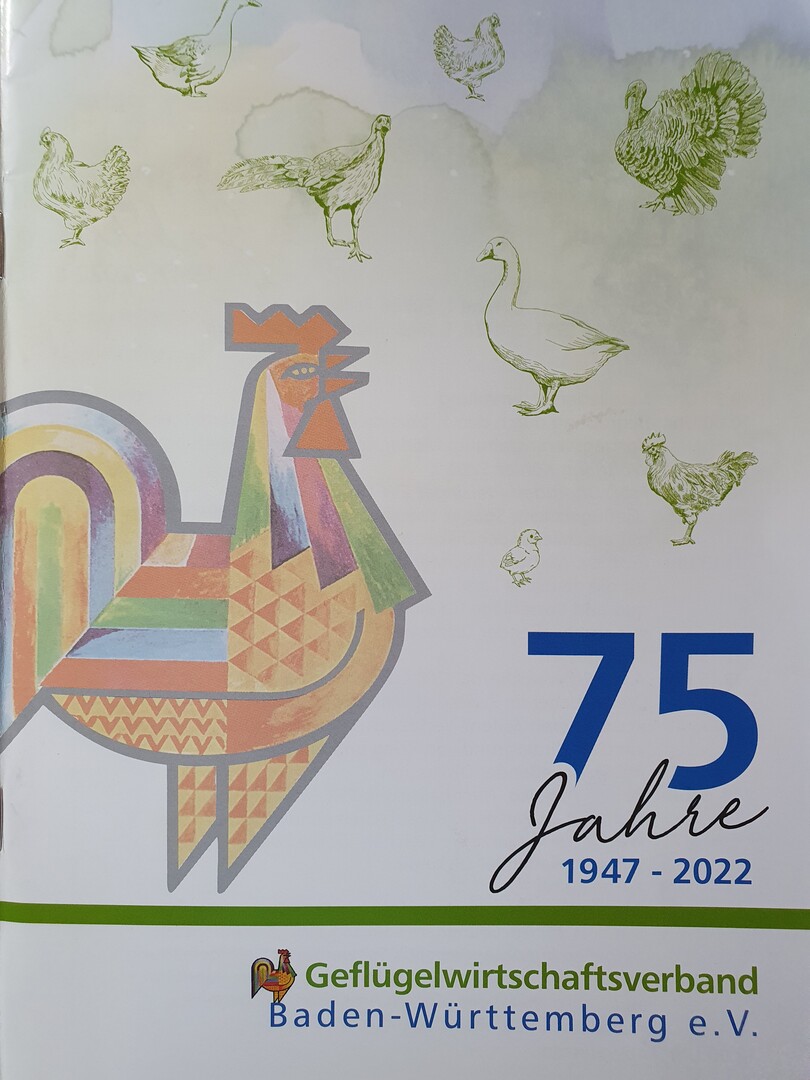




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.