Der Druck auf die Halter wächst
Ob berechtigt oder nicht: Die Anbindehaltung von Rindern gerät in der öffentlichen Diskussion zunehmend unter Druck. Zwar strebt der Gesetzgeber derzeit kein konkretes Verbot an, aber es gab bereits Initiativen auf Länderebene, zumindest die ganzjährige Anbindehaltung mit einer Übergangsfrist von zwölf Jahren zu verbieten.
- Veröffentlicht am

Im April 2016 hat der Bundesrat eine Entschließung dazu gefasst. Dieser ist der Bund jedoch unter anderem mangels Folgenabschätzung nicht gefolgt. Letztere wird inzwischen erarbeitet, so dass früher oder später sicher weitere Gesetzes-initiativen zu erwarten sind. Der Druck wird allerdings von einer anderen Seite schon heute wirksam.
Lebensmitteleinzelhandel (LEH) kritisiert Haltungsform
Die großen Firmen des Lebensmitteleinzelhandels versuchen unter anderem über Nachhaltigkeitsstrategien ihr Image gegenüber dem Verbraucher zu profilieren, um sich dadurch im Wettbewerb besser zu positionieren. In diesen Konzepten spielt das Tierwohl eine große Rolle.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, formulieren immer mehr Molkereien Anforderungen an die Produktionsbedingungen von Milch. Was zunächst Erhebungen und freiwillige Aktionen sind, könnte zukünftig zum Standard werden.
Erste Tierwohllabel mit Kriterien für die Haltung von Milchkühen schließen die Anbindehaltung als zulässiges Haltungssystem aus. In Österreich erfasst eine Molkerei seit 01. Januar 2018 keine Milch mehr aus Betrieben mit ganzjähriger Anbindehaltung.
Auch wenn es tatsächlich vertretbare Formen der Anbindehaltung, wie zum Beispiel in Verbindung mit Weidegang/Auslauf, Einstreu und Fixierung mit Bewegungsfreiheit, gibt, lässt sie sich in der Kommunikation mit dem Verbraucher nur schwerlich unter dem Begriff Tierwohl einordnen.
Und spätestens an diesem Punkt ist das Risiko erkennbar, dass Milch aus Anbindehaltung vielleicht schon bald nicht mehr zu attraktiven Preisen zu vermarkten sein wird. Deshalb sollte sich jeder Betriebsleiter, der mittel- bis längerfristig Milch erzeugen will und seine Kühe in Anbindung hält, mit der Frage einer Umstellung auf Laufstallhaltung befassen. Neben einem Gewinn an Tiergerechtheit und Vermarktungsmöglichkeiten kann diese ja auch gravierende arbeitswirtschaftliche und hygienische Vorteile in Zusammenhang mit dem Melken haben.
Es ist nicht alles gut
Der Lebensmitteleinzelhandel und in dessen Gefolge einzelne Molkereien, greifen Positionen von Tierschützern und Tierärzten auf, um den vermeintlichen Verbraucherwünschen zu entsprechen. Erst im September 2017 hat sich die Bundestierärztekammer in einem Positionspapier für eine Weiterentwicklung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung mit einem verbindlich festgelegten Termin für den Ausstieg aus der Anbindehaltung ausgesprochen.
Demgegenüber stellen Bauernverbände und der Milchwirtschaftliche Verein im Land in ihren Positionen zum Thema fest, „dass die heutigen Anbindehaltungen in Bezug auf die geltenden gesetzlichen Anforderungen des Tierschutzes nicht zu beanstanden sind.“ Wer liegt nun richtig? Es gibt verschiedene Gutachten und Gerichtsurteile, die die dauerhafte Anbindehaltung von Rindern ohne regelmäßigen Auslauf als Verstoß gegen Paragraf 2 des Tierschutzgesetzes bewerten.
Dieser verlangt vom Tierhalter unter anderem, seine Tiere verhaltensgerecht unterzubringen und die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einzuschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. An einem Konflikt der Anbindehaltung damit gibt es keinen Zweifel und es erwächst definitiv Handlungsbedarf.
In diversen Regelwerken wie zum Beispiel die Empfehlungen des Europarates zum Halten von Rindern oder die Tierschutzleitlinie für die Milchkuhhaltung in Niedersachsen finden sich entsprechende Empfehlungen, den Tieren regelmäßig Zugang zu einem Laufhof oder Weidegang zu gewähren. In der Schweiz, in Österreich und Dänemark ist die ganzjährige Anbindehaltung verboten, teilweise gelten noch Übergangsfristen.
Wirkt die Strukturentwicklung?
In den letzten 20 Jahren hat sich in Deutschland die Anzahl an MLP-Betrieben mit Anbindehaltung um rund 80 Prozent (%) reduziert. Weniger als ein Viertel aller Milchkühe stehen noch in Anbindehaltung. Der Strukturwandel erzielt seine oft zitierte Wirkung. Das hilft den aktiven Milcherzeugern mit Anbindehaltung jedoch nicht unbedingt.
In Baden-Württemberg sind es schätzungsweise noch circa 2500 Milchviehbetriebe (35%) und ca. 50.000 Milchkühe (15%), die in diesem System gehalten werden. Eine besondere Betroffenheit gilt für rund 1600 Betriebe, die noch ganzjährige Anbindehaltung betreiben. Regional gesehen ist der Regierungsbezirk Freiburg besonders im Fokus, denn aufgrund der vorhandenen kleinen Betriebsstrukturen gibt es Landkreise mit über 50% Anteil Milchviehhalter mit Anbindehaltung.
In Bayern liegt der Anteil an Milchviehbetrieben mit Anbindehaltung bei 60%, was etwa 19.000 Betrieben entspricht. Mit über 15.000 Milchviehhaltern wirtschaftet dort fast die Hälfte aller Milchviehbetriebe noch mit ganzjähriger Anbindung. In Österreich und der Schweiz gibt es rund 70% Anbindehaltungs-betriebe in der Milcherzeugung, jedoch lediglich 3% können in Österreich ihren Tieren keinen Weidegang oder Auslauf bieten.


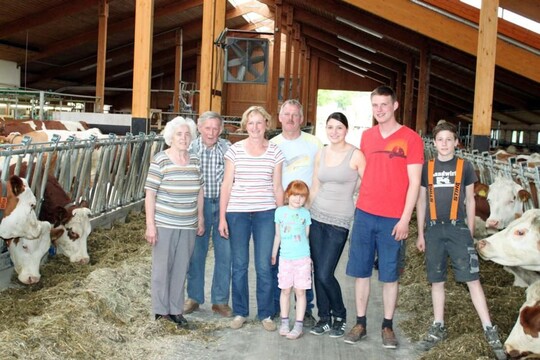




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.