Projekt erforscht Robustheit von Milchkühen
Manche sind von Natur aus robuster, andere zeigen sich krankheitsanfällig: in ein und derselben Herde reagieren Milchkühe ganz unterschiedlich auf körperliche Belastungen, wie sie die Geburt eines Kalbes, die anschließende Milchproduktion oder auch Infektionen mit sich bringen. Warum das so ist, dem geht jetzt ein neues Forschungsprojekt der Universität Hohenheim nach. Die Wissenschaftler wollen die Ursachen für die unterschiedliche Verfassung von Milchkühen herausfinden.
- Veröffentlicht am

Ein Grund für die unterschiedliche Robustheit sei, wie anpassungsfähig der Stoffwechsel der Kühe an die veränderten Anforderungen an den Körper ist. Die Ursache für die unterschiedliche individuelle Anpassungsfähigkeit sei, so die Wissenschaftler allerdings noch unklar. Ein Schlüssel hierzu könnte im Innenleben ihrer Zellen zu finden sein, genauer gesagt in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen. Aber auch die Interaktion zwischen Kuh und Darmbakterien spiele eine Rolle. Details dazu untersuchen derzeit zwei Arbeitsgruppen der Universität Hohenheim in Stuttgart.
Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, durch die Zucht vor allem Tiere zu gewinnen, bei denen sich Leistung mit Wohlbefinden kombiniert. Die beiden Teilprojekte werden von der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit einer Gesamtsumme von fast 520.000 Euro gefördert und zählen somit zu den Schwergewichten der Forschung.
Um ausreichend Milch bilden zu können, muss sich der Stoffwechsel von Kühen während der Trächtigkeit und nach der Geburt des Kalbes drastisch umstellen. Für die Milchproduktion muss in kurzer Zeit viel Energie bereitgestellt werden. Zugleich müssen aber auch die lebenswichtigen physiologischen Prozesse weiterhin aufrechterhalten werden.Die dafür erforderliche Energie wird in speziellen Organellen der Zelle, den Mitochondrien, erzeugt. Diese „Zellkraftwerke“ wandeln über komplexe Kettenreaktionen Sauerstoff und Zucker oder Fettsäuren in energiereiche Moleküle um, die von der Zelle für andere Stoffwechselvorgänge, wie beispielsweise die Produktion von Milchbestandteilen, genutzt werden können.
Einfluss von Mitochondrien auf die Stoffwechselstabilität
Allerdings könne sich nicht bei allen Kühen der Stoffwechsel ausreichend an die veränderte Situation anpassen, was oftmals zu Gesundheitsstörungen führe. Dabei gebe es von Natur aus sowohl robuste als auch anfällige Tiere in einer Herde. Das Kooperationsprojekt „Mitochondriale Funktionalität bei der Milchkuh“ geht deshalb jetzt der Frage nach, inwieweit die Mitochondrien für die Stoffwechselstabilität verantwortlich sind.
In einem multidisziplinären Ansatz arbeiten Prof. Dr. Korinna Huber vom Fachgebiet Funktionelle Anatomie der Nutztiere und Prof. Dr. Jana Seifert vom Fachgebiet Feed-Gut Microbiota Interaction an der Universität Hohenheim dazu mit Wissenschaftlern von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Braunschweig zusammen. Am FLI lebt auch die Herde mit circa 60 Holsteinrindern, die für das Projekt untersucht wurden. Dabei arbeiten alle vier Arbeitsgruppen mit den Daten aus einem zentralen Experiment. „Ohne diese Kooperation könnten wir die Versuche in ihrer Komplexität gar nicht durchführen“, betont die Sprecherin des Projektes Prof. Dr. Huber.
Wechselwirkungen zwischen Mikrobiom und Mitochondrien
In ihrem Teilprojekt widmet sich Prof. Dr. Seifert unter anderem der Frage, welche Rolle die Bakterienbesiedlung, das Mikrobiom, des Magen-Darm-Traktes auf die Funktion der Mitochondrien hat: „Wir wissen, dass es Wechselwirkungen gibt. Aber wir wissen noch nicht, ob das Mikrobiom die Mitochondrienfunktion beeinflusst oder umgekehrt.“ Aus Pansen, Dünndarm und Kot wurden mehrfach Proben genommen, um Veränderungen in der Bakterienzusammensetzung erfassen zu können. Dank eines fixen Zugangs bei den Kühen des FLI in Braunschweig ist es für die Wissenschaftlerinnen einfach, an den benötigten Pansen- und Dünndarminhalt heranzukommen. „Im Gegensatz zu anderen Methoden zur Probenentnahme, wie beispielsweise mit Hilfe einer Schlundsonde, verursacht dies den Kühen keinen Stress“, ist Prof. Dr. Seifert wichtig.
Erste Ergebnisse zeigen laut Prof. Dr. Seifert, dass „vor allem die Kühe die größten gesundheitlichen Probleme aufwiesen, deren Mikrobiom sich über den Untersuchungszeitraum hinweg am wenigsten veränderte, während diejenigen am besten mit den Belastungen zurechtkamen, deren Bakterienbesiedlung flexibel reagierte.“


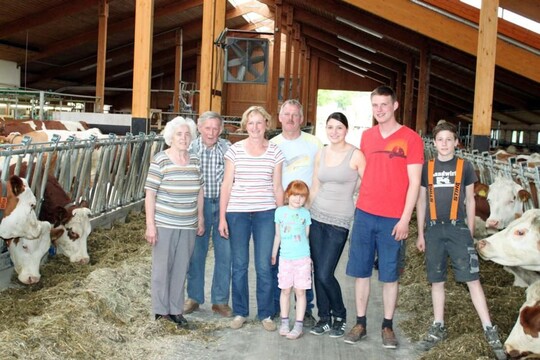







Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.