Bauernverband kritisiert Pflichtstilllegung
Drei Agrarexperten aus den Ministerien BMEL, MLR sowie dem DBV stellten am 3. März die neue GAP online vor. Eingeladen zur digitalen Fachtagung via Webex mit über 200 Zuhörerinnen und Zuhörern hatte der Landesbauernverband (LBV) unter der Leitung von Pressesprecherin Ariane Amstutz.
- Veröffentlicht am

Über die Eckpunkte der GAP ab 2023 und die Positionen des Berufsstandes berichtete Christian Gaebel vom Deutscher Bauernverband (DBV). Gaebel erinnerte daran, dass die Planungen bereits seit 2015 laufen und im EU-Haushalt immer wieder Anpassungen vorgenommen werden mussten, als Stichworte nannte er den Brexit, die Farm-to-Fork-Strategie und den Green-Deal. Nach zwei Übergangsjahren möchte man jetzt im Jahr 2023 tatsächlich mit der neuen Förderperiode bis 2027 beginnen. Doch bis heute sind noch nicht alle Fragen abschließend geklärt, unter anderen wird auf der EU-Ebene noch intensiv über die Durchsetzungsrechtsakte im EU-Recht verhandelt. Deutschland hat im Februar 2022 den Entwurf des Strategieplans in Brüssel eingereicht. Der wird jetzt auf europäischer Ebene geprüft, sodass der Plan spätestens im Herbst 2022 endlich stehen dürfte. Dabei braucht die Landwirtschaft dringend Klarheit, insbesondere bei den Fragen zum Fruchtwechsel. Die Zeit drängt.
Ein Erfolg für die Agrarförderung
Dass Deutschland 4,92 Mrd. Euro pro Jahr für die Direktzahlungen zur Verfügung stehen werden und 1,23 Mrd. Euro an ELER-Mitteln, wertet Gaebel als einen Erfolg für die Agrarförderung insgesamt. Die Mittel verteilen sich künftig mehr in Richtung Umwelt- und Naturschutz und hin zu und kleineren Betrieben und Junglanglandwirten. Junglandwirte können innerhalb von fünf Jahren bis zu 80.000 Euro Förderprämie bekommen. „Sehr schmerzlich ist die Absenkung der Basisprämie“, sagt Gaebel. Positiv hingegen sei, dass es keine Anwendung der Degression in Deutschland geben wird sowie eine Förderung der ersten Hektare. Außerdem komme es zu einer Entkoppelung der Tierkennzeichnungspflichten von den Direktzahlungen. Ebenfalls positiv sei, dass man für Dauergrünland eine praktikable Stichtagslösung gefunden habe und dass es zu keiner sanktionierten Nährstoffbilanzierung für N und P kommen wird. „Die Nachweispflichten sind hier nicht so streng wie ursprünglich geplant“, zeigte sich Gaebel zufrieden.
GLÖZ-Standards erfordern Vorleistungen
Gaebel betonte, dass für die Betriebe erst einmal Kosten für die Einhaltung der neuen grünen Architektur entstünden. Diese Vorleistungen treffen übrigens auch die kleineren Betriebe und auch die Öko-Betriebe. Grundlage zum Erhalt der Basisprämie, der sogenannten Konditionalität, sind Vorgaben zur Bewirtschaftung der Flächen nach guter landwirtschaftlicher Praxis, die sogenannten GLÖZ-Standards 1 bis 9. Heiß diskutiert werden derzeit besonders GLÖZ 6 "Mindestbodenbedeckung in sensiblen Zeiten", GLÖZ 7 "Fruchtwechsel" sowie vor allem auch GLÖZ 8 mit einem Mindestanteil der landwirtschaftlichen Flächen für nichtproduktive Flächen (Stilllegung 4 Prozent des Ackerlandes).
Verband sieht Pflichtstilllegung kritisch
LBV-Vizepräsident Klaus Mugele kritisierte die Ausgestaltung der nicht produktiven Flächen in Deutschland. Bei den vier Prozent Pflichtstillegung müsse man die Flächen ab der Ernte der Vorfrucht sich selbst überlassen, und solle dann zugucken, was darauf wächst. Das könne es nicht sein. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nahrungsmittelknappheit seien Stilllegungen grundsätzlich zu hinterfragen, findet Mugele und forderte hier eine Neubewertung. ,„Anstatt dieser Pflichtbrachen bei GLÖZ 8 hätte das EU-Recht auch andere Optionen erlaubt,“ bestätigt Gaebel. Ein Punkt, der so in dieser Form vom Berufsstand abgelehnt wurde, bei dem man sich allerdings leider nicht hatte durchsetzen können. An so mancher Stelle bei der nationalen Umsetzung der GAP sei man nicht besonders pragmatisch vorgegangen. Positiv sei, dass man sich die ohnehin schon bestehenden Landschaftselemente und/oder Pufferstreifen als Brache mit anrechnen lassen kann.
Prämien für Öko-Regelungen zu gering?
Ebenfalls kein Geheimnis ist es, dass der Bauernverband die Öko-Regelungen (eco-schemes) insgesamt als eher kritisch einstuft. Gaebel geht davon aus, dass hier einige Betriebe nicht mitmachen werden, weil es sich für sie finanziell nicht rechnen wird. Dies müsse jetzt erst einmal abwarten und dann gegebenenfalls die Prämien anpassen.
Jeder zweite Euro für mehr Umwelt- und Klimaschutz
Über den deutschen GAP-Strategieplan aus Bundesperspektive sprach Dr. Gisela Günter vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL). Schwerpunkte der Ausgestaltung seien eine krisenfeste Landwirtschaft und die grüne Architektur. Für Deutschland gibt es 30 Mrd. Euro für 2023 bis 2027 zu verteilen (über 21. Mrd. Euro Direktzahlungen und über 8 Mrd. ELER-Mittel als Umverteilungsgelder für die 2. Säule. Günter rechnet mit bundesweit jährlich 300.000 Anträgen aus der Landwirtschaft für die 65 verschiedenen Fördermaßnahmen (36 in der 1. Säule und 29 in der 2. Säule). Ziele des GAP-Strategieplans seien die Ernährungssicherheit, die gerade wegen der weltweiten Verknappung der Agrarrohstoffe an Bedeutung gewinnt, die Stärkung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie die Stärkung des ländlichen Raumes. Im Jahr 2027 sollen für Umweltleistungen etwa die Hälfte der Gesamtmittel aufgebracht werden. Durch die Umverteilung der Gelder in die 2. Säule sinkt die Basisprämie auf 149 Euro pro ha im Jahr 2027, so der Plan.
Starke Förderprogramme im Land
Einerseits ist diese deutliche Umverteilung das politische Ziel der neuen GAP. Andererseits ermöglicht sie den Ländern, ihre Programme zu erweitern und anzupassen. Das berichtete Andrea Stief, Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg (MLR), in ihrem Vortrag zur Ausgestaltung der 2. Säule. Allein im Land sind 16 verschiedene Förderprogramme geplant vom AFP über die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und FAKT II bis zum LEADER-Programm. Insgesamt gibt es über 1,5 Mrd. Euro ELER-Mittel von 2023 bis 2027 zu verteilen. Davon entfallen fast 600 Mio. Euro auf FAKT, 30 Mio. Euro für den Wald und 170 Mio. Euro Landschaftspflegerichtlinie LPR. Neu ist, dass man bei AFP noch stärker in Richtung Tierwohl und Emissionsminderung geht, hinzu kommen die Förderung von vorbeugenden Maßnahmen gegen Extremwetterereignisse sowie Förderung von Ertragsversicherungen sowie Klimaresillienz der Wälder und Wissenstransfer. Alle Maßnahmen müssten im Zusammenhang mit der 1. Säule gesehen werden. „Wir haben unsere Ausrichtung im FAKT so gelegt, dass es keine Überschneidungen gibt", meinte Stief und verweist darauf, dass damit eine große Bandbreite an Kombinationen möglich sein soll.
Fragen und Antworten aus dem Chat (ohne Gewähr)
- Wenn man 2022 in die Junglandwirteprämie einsteigt, gelten dann fünf Jahre lang die alten Sätze oder geht das dann automatisch in die neuen Sätze über?
Ab 2023 gelten die neuen Sätze. - Sind Milchziegen und Milchschafhalter bei den gekoppelten Tierprämien ausgeschlossen?
Nein. - Inwieweit wird FAKT beeinträchtigt, Stichwort Doppelförderung?
Es darf keine Doppelförderung geben. Deswegen wurden in FAKT neue Maßnahmen aufgenommen und alte abgeschafft. - Silomais-Stoppel mulchen. Reicht das als Bodenbedeckung?
Ja, aber man muss mulchen. Stoppel einfach stehen lassen reicht nicht. - GLÖZ 6 (Mindestbodenbedeckung) beeinträchtigt den Gemüsebau. Warum gibt es hier nur Ausnahmen für Kartoffeln?
Der DBV hat daraufhin gewiesen, das Feldgemüse, Zuckerrüben und sämtliche späträumende Kulturen gesondert zu betrachten sind. Hier muss für alle diese Kulturen ein Weg gefunden werden, nicht nur Kartoffeln. - Sind die Brachen und Stilllegungen übertragbar in andere Länder und/oder andere Bundesländer?
Übertragbarkeit ins Ausland geht nicht. In andere Bundesländern müsste das eigentlich gehen. - Steigende Preise für Lebensmittel, Stichwort Ukrainekrieg. Kann man sich da die Brachen überhaupt noch leisten?
Der DBV und auch die EU-Agrarminister unterhalten sich darüber gerade. Das Grüner-Werden der GAP wird nicht infrage gestellt, aber es kann sein, dass man hier noch nachjustiert. Das muss man jetzt mal sehen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll produktionserhaltende Maßnahmen zu ergreifen, wie auch immer das im Detail aussieht. Wir erleben ja gerade, dass grundlegende Beschlüsse hinterfragt werden. Auch im Bereich Landwirtschaft kann man über einiges neu nachdenken und neu bewerten. Wenn der GAP-Strategieplan jedoch so genehmigt wird, würde zunächst mal GLÖZ 8 gelten. - Ab wann gelten die GLÖZ-Standards?
GLÖZ 7 Fruchtwechsel gilt wegen der Anbauplanung schon ab 2022. Hier muss der Bund nochmal klar sagen, was ab wann genau gilt. - Lohnt sich die Teilnahme an der GAP überhaupt noch? Kann man nur die 2. Säule beantragen und die 1. Säule nicht?
Grundlagen für sämtliche Anträge sind die Flächen. Wer die Konditionalität nicht einhält, dem werden auch die Prämien für Flächen und Tiere in der 2. Säule gekürzt und im Extremfall gestrichen. - Bisherige Gewässerrandstreifen unter 0,1 ha sind als Brache weiter möglich?
Inwieweit Gewässerrandstreifen als Stilllegungsflächen eingebracht werden können, ist noch nicht 100 prozentig geklärt. - Warum sind die Umschichtungen von der 1. auf die 2. Säule so hoch?
Es ist ein politisches Ziel, die Nachhaltigkeit und den Klima- und Umweltschutz zu verbessern. Und: Man hat damit auch den Ländern geholfen, damit sie genügend Geld für ihre 2. Säule-Programme zur Verfügung haben. - Sind die GLÖZ-Standards europaweit gleich?
Es gibt Ausgestaltungsspielräume. Aber ja, im Prinzip schon. Umstritten ist u.a. die Umsetzung von GLÖZ 8 in Deutschland. Laut DBV war man bei der Umsetzung der Konditionalitätspflichten hierzulande mal wieder besonders eifrig. Das sieht man an der Einschränkung auf 50 Prozent der Ackerfläche bei der Anrechnung GLÖZ 7 Fruchtwechsel oder bei den GLÖZ 8 Brachen. - Was für eine Ausbildung braucht ein Junglandwirt?
Hier gibt es verschiedene mögliche Qualifikationsnachweise, angefangen von einem abgeschlossenen landwirtschaftlichen Studium, einer landwirtschaftlichen Berufsausbildung oder mindestens 300 Stunden einer Fortbildungsmaßnahme bis zu einer mindestens zweijährigen Tätigkeit in einem oder mehreren landwirtschaftlichen Betrieben, was durch einen Arbeitsvertrag mit mindestens 15 Wochenstunden oder einer krankenversicherungspflichten Beschäftigung in einem Betrieb nachzuweisen ist. - Sind die eco-schemes mehrjährig oder einjährig? Grundsätzlich gilt hier die Einjährigkeit: Einjährige Beantragung, die dann je nach Maßnahme jährlich wiederholt werden kann. Man muss sich die Öko-Regelungen genau anschauen.
- Vier Prozent Stillegung. Kann man da auch die bisher schon stillgelegten Flächen nehmen?
Ja, kann man. Nach aktuellem Stand gibt es da keine Einschränkung was aus der Erzeugung genommen werden darf. - Reicht das Geld für die Weiterbildung bei so vielen Neuerungen?
Ja, das war damals bei MEPL auch so. Wenn es erforderlich wird, wird es hier auch noch Änderunsanträge geben und zur Not noch Geld umgeschichtet. - D1 für Grünland. Hier wurde um mehr als die Hälfte gekürzt 80 Euro anstatt 190 Euro. Grünland-Betriebe im Schwarzwald sind da sehr benachteiligt. Was war der Grund für die Kürzung?
Der Grund: Früher hatte man die Prämie für Acker, Dauerkulturen und Grünland für einen durchschnittlichen Gemischtbetrieb kalkuliert und die Pflanzenschutzaufwendungen für einen Dauerkulturbetrieb waren viel höher, deswegen die höhere Prämie. Nun gilt sie nur für Grünland. - Bei der Verminderung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel gehört da der Mineral-Dünger auch dazu? Ja.
- Wie ist die Winterbegünung bei Zuckerrüben umzusetzen?
Diese Frage ist noch ungelöst. Hier ist man dran. - Lässt sich kennartenbezogenes Dauergrünland mit Ökoanbau kombinieren?
Laut der Kombinationstabelle, die man auf Bundesebene erstellt hat, kann man das machen. Da muss man sich auch die Kulturen genau anschauen.
Hinweis: Die Fachtagung gibt es zum Nachhören unter https://www.youtube.com/watch?v=Ky2bk8qhUfk







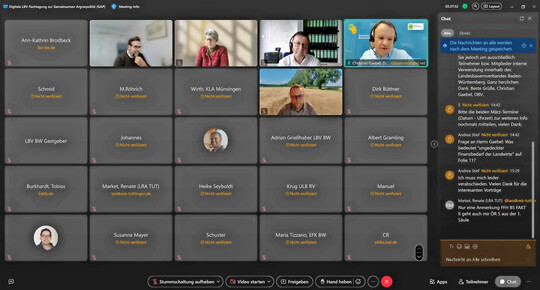
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.