Sauberkeit und Hygiene schützen vor Infektionskrankheiten
Der Melkstand ist häufig der Ort im Milchviehbetrieb, an dem die üblichen Biosicherheitsmaßnahmen bereits geläufig sind. Dort wird gereinigt, desinfiziert und es werden kranke Tiere separiert. Worauf es bei den Maßnahmen ankommt, was speziell bei Sauberkeit und Hygiene beachtet werden soll, haben wir für Sie zusammengefasst.
- Veröffentlicht am

Auch im Melkstand lauern Gefahren für die Gesundheit der Tiere. Auf der Hand liegen hier Infektionsgefahren für Euterentzündungen. Die Quelle einer solchen – meist durch Bakterien verursachten – Mastitis findet sich beispielsweise in Milchresten von erkrankten Kühen, auf Melkerhänden, in Melkbechern oder auf mehrfach verwendeten Euterfetzen sowie in Schmutzresten am Euter, die bei der Vorreinigung übersehen wurden oder im Melkzeug zurückgeblieben sind.
Vielfältiges Infektionsrisiko
Aber natürlich können sich auch andere infektiöse Krankheiten über die Engstelle Melkstand, die eine unumgängliche Stallzone mit viel Körperkontakt für alle Kühe ist, verbreiten. Erwachsene Kühe können zum Beispiel Opfer einer Trichophytie werden und den Hautpilz über die Melkstandaufstallung an die Artgenossen weitergeben. Auch Papillomavieren, die Auslöser für (Euter-)Warzen beim Rind sind, können hier übertragen werden. Bei beiden Erkrankungen ist zudem das Melkpersonal gefährdet, da sich auch der Mensch infizieren kann. Worauf kommt es also im Einzelnen an?
Strikte Melkhygiene: Vormelken, Reinigen und Zwischendesinfizieren sind nicht nur ein Muss für beste Milchqualität und zur Kontrolle der Eutergesundheit, sondern schützen Kühe und Melker auch vor Infektionen. Im Handel werden für alle Bereiche der Melkhygiene bereits eine Vielzahl von Produkten angeboten. Wichtig ist, diese entsprechend der Anleitung anzuwenden, zu dosieren und zu lagern.
Nur so können sie den versprochenen Nutzen bringen. Darüber hinaus sind einige Schritte und Mittel häufig aufeinander abzustimmen. Wer Melkzeuge zwischendesinfiziert und desinfizierend reinigt, muss in ein pflegendes Dippmittel investieren, um die beanspruchte Zitzenhaut wieder zu pflegen, um so diese natürliche Barriere zu unterstützen.
Ein Reinigungstuch pro Kuh: Seit Jahrzehnten haben nun Studien, Befragungen und Auswertungen von Daten belegt, dass das Mehrfachverwenden von Eutertüchern und der sogenannte „Euterfetzen“ ein unbeschreibliches Infektionsrisiko für Mastitiden birgt und zu durchschnittlich höheren Zellzahlen im Bestand führt. Es ist unbestritten Zeit, den Euterlappen nur noch im Museum und nicht im modernen Milchviehbetrieb zu sehen. Mehrwegtücher, die in ausreichender Anzahl pro Kuh zur Verfügung stehen und nach jedem Gebrauch im Kochwaschgang gewaschen werden, zählen da nicht dazu. Bei entsprechender Führung kann dieses System funktionieren.
Handschuhe tragen: Die glatte Oberfläche aus Latex oder Vinyl bietet weniger Anhaftfläche für Schmutz und Keime und schützt den Melker vor Infektionen durch etwaige Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragbar sind. Auch bevorzugen gerade Melker, die feucht-desinfizierend reinigen, Handschuhe, da der übermäßige Kontakt mit Nässe und Desinfektionsmittel für die menschliche Haut nicht optimal ist.
Lesen Sie den gesamten Fachbeitrag von Johanna Mandl von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich in der aktuellen Ausgabe 17/2023 von BWagrar, die 29. April 2023 erscheint.


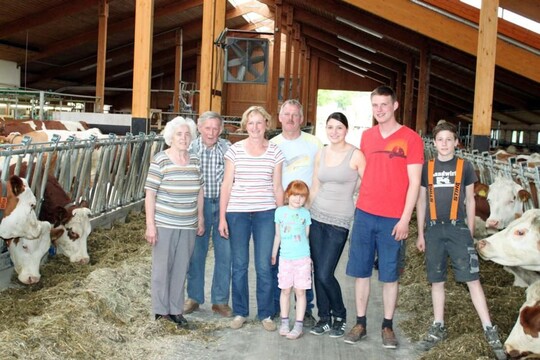






Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.