Tipps für eine erfolgreiche Hofnachfolge
Auf großes Interesse stießen die diesjährigen VR-Agrartage zum Thema „Hofnachfolge.Gemeinsam.Gestalten.“ in Künzelsau am 7. November und in Laupheim am 21. November. Abschluss der Tage ist am 28. November in Sigmaringen. Allein in Laupheim waren es über 400 Besucher. Für Unterhaltung sorgte der Zauberkünstler Maurice Grange mit kurzweiligen Einlagen aus seinem preisgekrönten Programm „Willkommen in der Welt der Illusionen“.
von Matthias Borlinghaus Quelle Matthias Borlinghaus erschienen am 26.11.2024Der Genossenschaftsverband (BMGV) mit seinen insgesamt über 3,8 Millionen Mitgliedern möchte seinen landwirtschaftlichen Mitgliedern in Sachen Unternehmensnachfolge individuell zur Seite stehen. Dabei liegt die Betonung auf individuell, weil eine Hofübergabe eine komplexe Angelegenheit ist, die Dr. Enno Bahrs, Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre an der Universität Hohenheim, in seinem Vortrag nicht ohne Grund als ökonomische Königsdisziplin bezeichnete, für die man sich genügend Zeit nehmen sollte. „Wer das nicht erkennt, macht schon im Ansatz einen zentralen Fehler“, meinte Bahrs. Moderator Oliver Knab, wies auf die Bedeutung des Themas hin: „Die meisten Höfe im Südwesten sind über Jahrhunderte gewachsen, immer mit dem Ziel, Bestehendes zu bewahren und weiterzuentwickeln.“ Laut Blitzumfrage steht bei immerhin zwei Drittel der Teilnehmer im Saal in den nächsten zehn Jahren eine Hofnachfolge an.
Mehr als nur ein Generationenwechsel
„Die Hofnachfolge bedeutet, ein Lebenswerk weiterzugeben“, meint Ute Bader, Abteilungsleiterin MitgliederCenter beim BWGV. Dabei müssten die Übernehmer oft unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten und gleichzeitig neue Wege finden, die Höfe wettbewerbsfähig in die Zukunft zu führen. Keine einfache Angelegenheit. „Wir brauchen gut ausgebildete Menschen, die wissen, worauf sie sich bei der Landwirtschaft einlassen, und den Mut aufbringen, hier einzusteigen und was Neues ausprobieren wollen“, machte LBV-Vizepräsidentin Rosi Geyer-Fäßler, die sich für bessere Rahmenbedingungen für die heimischen Betriebe einsetzt, Lust auf Landwirtschaft. Bei der Hofübergabe gebe es viele Facetten, sagte sie. Erste Anlaufstelle seien die Geschäftsstellen der Kreisbauernverbände, die einem hier auf jeden Fall weiterhelfen können.
Praxisbeispiel aus dem Schwarzwald
„Morgen kann kommen, wenn man vorbereitet ist“, sagt die Familie Günter. Erika Günter blickt erleichtert auf ihre Übergabe vor gut einem Jahr zurück. De facto sei sie nun eine Altbäuerin, meint sie, ihr Mann Dr. Josef Günter muss sich an die Bezeichnung Altbauer erst noch gewöhnen, sagte er. Auf dem arrondierten Betrieb im Schwarzwald mit seinen 17 ha Grünland und 30 Hektar Wald wird traditionell Milchvieh gehalten. Etwa drei Viertel der Milch von den 24 Braunviehkühen wurde auf dem Betrieb zu Käse verarbeitet, der Rest an eine Molkerei verkauft. Außerdem gibt es acht Mastschweine, mehrere PV-Dachanlagen und drei Ferienwohnungen, zwei davon befinden sich im Leibgedinghaus, in dem auch die Eltern von Erika noch wohnen. Der Hof wird biologisch bewirtschaftet. Über 15 Jahre lang waren die Günters auf dem Wochenmarkt präsent, um dort ihren Käse einschließlich Joghurt und Frischkäse zu verkaufen. „Wir haben den Betrieb aus der Nische heraus in eine neue Branche hinein entwickelt, waren damals Pioniere, wussten aber immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erzählte Josef Günter. In den vergangenen Jahren tauchte nach und nach die Frage auf, wie es weitergehen soll. Die Günters haben zwei erwachsene Töchter, die den Hof nicht weiter bewirtschaften möchten.
Entscheidungsfindung
Zunächst gab es erste Vorgespräche innerhalb der Familie, es wurden Seminare zur Hofübergabe besucht. Zudem wurde ein Coach mit eingebunden. „Wir wollten nicht, dass wir uns in der Familie zerstreiten, wenn es um Geld geht“, meinte Josef Günter. Die Hofübergabe sei ein riesiger Berg, den man Stück für Stück abarbeiten müsse. Zusammen mit dem Berater kam man in der Familie der Entscheidungsfindung nach und nach immer näher. „Klar war, dass wir auf der Hofstelle weiter wohnen wollten. Klar war auch, dass wir keine gemeinsame Bewirtschaftung wollen mit dem Übernehmer“, so Günter. Entschieden wurde dann, dass die beiden Töchter den Hof bekommen. Dazu haben die beiden eine eGbR gegründet (eine notariell eingetragene GbR). Und, dass die Landwirtschaft an Fremde verpachtet werden soll. Der Plan: Die Flächen sollten weiter biologisch bewirtschaftet werden, sie sollten mit dem Vieh und der Käserei eine Lebensgrundlage für eine Familie darstellen. In einem spannenden Vortrag erläuterten die Günters den erfolgreichen Prozess, wie sie ihre Nachfolger gefunden haben.
Formal gibt es heute zwei Betriebe: Die Nachfolger, eine junge Familie aus Rheinhessen, treibt die Landwirtschaft und die Käserei um. Die Günters kümmern sich nach wie vor um den Wald und um die Ferienwohnungen. Betriebswirtschaftlich war die Pachtwertermittlung ein Kernelement. Die Pacht setzt sich zusammen aus der Flächenpacht, plus Werte für Maschinen und Geräte, plus Mietwerte, plus Nebenkosten, plus Auszahlungsbetrag an die Übergeber. „Da kommt einiges zusammen. Hier darf man nicht zu hart verhandeln, sonst schaffen es die Übernehmer wirtschaftlich nicht“, riet Günter. Folgende Punkte seien wichtig:
- Ein schuldenfreier Hof lässt sich leichter übergeben
- Kein Investitionsstau
- Alle Menschen auf dem Hof müssen gut leben können
- Achtung der Privatsphäre
- Gegenseitiges Wohlwollen
Fazit: „Unsere Töchter konnten sich nicht vorstellen, ihre Heimat zu verkaufen. Mit der Verpachtung an Fremde haben sie die Möglichkeit, ihre Heimat zu behalten“, sagte Erika Günter. Und: „Für alle Ewigkeit kann ich nicht sprechen. Vielleicht geht es in 20 Jahren darum, den Hof zu verkaufen. Ich kann für die Zukunft nichts versprechen. Aber den Schuh des Verkaufs wollte ich mir nicht anziehen.“
Wichtige Eckpunkte
Nießbrauchsrechte, Pachtrechte, Rückübertragungsmöglichkeiten, Nachabfindungsregelungen: Man sollte möglichst versuchen, alle Eventualitäten, die eintreten können, beim Hofübergabevertrag zu berücksichtigen, meinte Enno Bahrs. Am besten gehe das, wenn der Betrieb wirtschaftlich erfolgreich sei. Politisches Ziel sei es, Betriebsteilungen zu verhindern (Anerbengesetze). Dafür gibt es den Paragrafen 2049 BGB, in dem ein übertragendes Landgut mit dem Ertragswert abgesetzt werden kann, um daraus auch die entsprechenden Abfindungszahlungen an die weichenden Erben abzuleiten, also nicht den deutlich höheren Verkehrswert. Zudem gibt es das Grundstücksverkehrsgesetz, über das der Hof und die Agrarstruktur erhalten bleiben sollen. Ungemein wichtig bei der Übergabe sei die Absicherung der Übergeber. „Die abgebende Generation muss finanziell ausreichend abgesichert sein“, so Bahrs. Dazu reiche das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) allein, also das gesetzliche Altersgeld, längst nicht aus. Im besten Fall haben die Übergeber privat fürs Alter vorgesorgt oder es müssen die Übernehmer die Altersvorsorge „sicherstellen, soweit es der Betrieb erlaubt“. Hier brauche es eine „gute Kompromissfähigkeit“ von Seiten der Übergeber, denn die Altenteilerleistungen müssen meist aus den betrieblichen Erträgen bezahlt werden. Steuerliche Aspekte hält Bahrs für beherrschbar: „Das Ertrags- und das Erbschaftssteuerrecht ist üblicherweise kein Hemmschuh, wenn man es rechtzeitig und angemessen vorbereitet.“ Auch hier müsse man vorher ausführlich darüber sprechen und vor allem selbst klare Ziele haben. Bahrs rät dringend dazu, externe Beratungsdienstleistungen, die insbesondere von den berufsständischen Vertretungen angeboten werden, rechtzeitig in Anspruch zu nehmen.
 © Matthias Borlinghaus„Machen Sie ein Testament, das zu Ihren Hofübergabezielen passt.“ Dr. Enno Bahrs, Uni Hohenheim
© Matthias Borlinghaus„Machen Sie ein Testament, das zu Ihren Hofübergabezielen passt.“ Dr. Enno Bahrs, Uni Hohenheim
„Machen Sie ein Testament, das zu ihren Hofübergabezielen passt, zur nachfolgenden Generation und zu den weichenden Erben. Dies gilt auch schon für die jungen Hofnachfolger ab 25, auch sie sollten ein mit allen Beteiligten abgestimmtes Testament haben“, riet Enno Bahrs. Ihm zufolge seien die Hofnachfolger hochmotiviert und bestens ausgebildet. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die übergebende Generation die Freude an der Arbeit offenkundig erfolgreich weitergegeben habe. „Die jungen Hofnachfolger wollen verantwortungsvolle Unternehmer und Unternehmerinnen sein“, brach Bahrs eine Lanze für seine Studenten, räumte aber gleichzeitig ein, dass sie durchaus andere Erwartungen an die Arbeit hätten als ihre Eltern. An die Übergeber gerichtet, meinte Bahrs: „Sie müssen nicht alles vernünftig finden, was vorgeschlagen wird, aber Sie sollten dafür offen sein.“ Die Übernehmer wiederum könnten stolz darauf sein, was die abgebende Generation geleistet hat – Stichwort: Respekt für das Lebenswerk, das oftmals über mehrere Generationen aufgebaut wurde. Gleichzeitig gehe es bei der Hofübergabe immer auch um die Sicherung des Arbeitsplatzes. Falls nötig könne hier der Nebenerwerb ebenso eine gute Lösung sein.
Immer weniger Betriebe
In Baden-Württemberg werden zwei Drittel der Betriebe im Nebenerwerb geführt. Laut DZ-Bank-Prognose dürfte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland von heute über 200.000 auf 100.000 Betriebe im Jahr 2040 regelrecht halbieren. Gleichzeitig steigt in diesem Zeitraum die bewirtschaftete Fläche von heute durchschnittlich rund 70 Hektar in Deutschland (in Baden-Württemberg sind es im Schnitt unter 40 Hektar) auf 160 Hektar pro Betrieb an. „Der Hof geht vielleicht, die Fläche bleibt“, kommentierte Bahrs die Entwicklung. Er glaubt fest daran, dass die Flächen in jedem Fall in irgendeiner Form weiter bewirtschaftet werden.
Verschiedene Rollen
„Wie kann das Zusammenleben und Zusammenarbeiten im bäuerlichen Familienbetrieb gelingen?“ Darüber sprach Barbara Kathrein, entra beratung agrar. In der Landwirtschaft müsse man naturgemäß verschiedene Rollen einnehmen – einerseits im Familien-, und anderseits im Arbeitsbereich – und das ständig im Wechsel. Viel zu oft würde nur über den Betrieb geredet und das Familienleben vernachlässigt. „Als Mutter muss ich zu meinem 19-jährigen Sohn, wenn er morgens um 5 Uhr von der Party kommt, sagen, jetzt schlaf dich erst mal aus. Als Betriebsleiterin muss ich ihm sagen, dass er um 6 Uhr zum Melken im Stall sein oder eben Urlaub nehmen muss“, veranschaulichte Kathrein, welche Herausforderungen in diesen unterschiedlichen Rollen stecken. Wichtigster Punkt für Kathrein ist, dass man immer im Gespräch bleibt, in einem wertschätzenden, freundlichen Umgang, auch wenn es schwierig wird. „Ich erlebe so oft in meinen Beratungen Dinge, wo es nicht passt, anstatt auch mal zu schauen, wo es überall gut läuft“, sagte sie und plädierte für klare Absprachen und Spielregeln, um so Freiräume zu schaffen und die Zufriedenheit zu erhöhen.
Wichtige Punkte sind:
- Familie und Betrieb sind zwei Systeme und eine Welt
- Im Gespräch bleiben
- Achten auf Nähe und Distanz, Vertrauen, Zutrauen und Zugestehen
- Veränderung aktiv gestalten
Tipps: (1) Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin für die Hofübergabe. Machen Sie den ersten Termin ausschließlich mit ihren Kindern (Kernfamilie), nicht mit deren Lebenspartnern. (2) Die größte Falle ist, dass man beginnt, für die anderen zu denken. (3) Man sollte sich nicht scheuen, mehrere Berater zu testen, bis man den passenden gefunden hat. Ein guter Berater hilft, den Prozess zu strukturieren und lässt neue Ideen zu, ohne sie gleich zu bewerten.








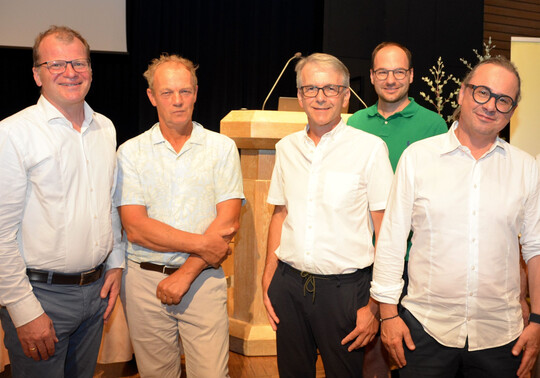

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.