
Mief raus – Frischluft rein
Viele Pferde leiden unter Atemwegserkrankungen. Als eine mögliche Ursache gilt schlechtes Stallklima. Damit im Pferdestall kein Mief, sondern möglichst frische Luft herrscht, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
von Peggy und Sven Morell, Pferdefachjournalisten, Stocksberg Quelle Peggy und Sven Morell, Pferdefachjournalisten, Stocksberg erschienen am 09.04.2025Ein durchschnittliches Warmblutpferd inhaliert in Ruhe etwa 50 bis 80 Liter Luft pro Minute. Da erstaunt es nicht, dass das Stallklima essenziellen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Vierbeiner hat. Doch was heißt „gutes“ Stallklima? Wie kann es gewährleistet werden? Und: Was macht ein gutes Stallklima aus? Die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten, herausgegeben vom Referat Tierschutz des damaligen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), nennen folgende Anforderungen an das Pferdestall-Klima:
- Die Temperatur im Stall soll in etwa der Außentemperatur entsprechen – sommers wie winters (ausgenommen bei hohen oder niedrigen Temperaturen). Nur so könne die natürliche Thermoregulation der Pferde trainiert werden.
- Hohe Luftfeuchtigkeit fördert das Wachstum von Keimen und Schimmel, zudem wird die Thermoregulation gestört. Zu trockene Luft hingegen reizt die Atemwege. Laut Leitlinien sind etwa 60 bis 80 Prozent relative Luftfeuchte für einen Pferdestall ideal.
- Damit verbrauchte Luft (beziehungsweise Wasserdampf, Schadgase, Staub und Keime) gegen Frischluft ausgetauscht werden kann, ist eine Luftbewegung von mindestens 0,2 Meter pro Sekunde notwendig. Höhere Luftgeschwindigkeiten führen zu einer vermehrten Wärmeabgabe – was im Sommer jedoch durchaus erfrischend sein kann.
- In jedem Pferdestall entstehen Schadgase durch die Zersetzung von Urin und Kot sowie die Ausatemluft der Pferde. Als Grenzwerte gelten für Kohlendioxid (CO2) 1000 parts per million (ppm), die Ammoniakkonzentration (reizt Atemwege und Augen, greift die Hufe an) darf 10 ppm nur kurzfristig und ausnahmsweise überschreiten. Schwefelwasserstoff hat im Pferdestall normalerweise gar nichts zu suchen, werden dennoch Spuren nachgewiesen, sei dies ein Hinweis auf extrem unhygienische Zustände.
Natürliche Belüftung
Für ein gutes Stallklima ist eine ausreichende Belüftung unerlässlich. Am einfachsten ist: Fenster und Stalltor aufmachen – und zwar auch im Winter. Diese simple Maßnahme wird leider noch immer in vielen Ställen nicht oder zu wenig genutzt. Vor allem, sobald es draußen etwas kühler wird, werden oft sämtliche Luken verschlossen, auch damit es im Stall „behaglicher“ ist. Was für den Zweibeiner vielleicht angenehm sein mag, ist für Pferde kontraproduktiv. Sie brauchen neben der frischen Luft im Winter den Kältereiz, um ihre Thermoregulation zu trainieren. Die Ausrede „damit die Tränken nicht einfrieren“ funktioniert nicht – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Tränken und Wasserleitungen vor Frost zu schützen. Luken, durch die die Pferde ihre Köpfe hinausstrecken können, bieten nicht nur reichlich Frischluft, sondern auch zusätzlich viel Tageslicht. Schließlich ist ausreichend Licht ebenfalls wichtig für das Stallklima. Mitunter ist ein nachträglicher Einbau in ein bestehendes Gebäude möglich, allerdings muss vorher geprüft werden, ob die Statik einen solchen Umbau zulässt.
Anlage verbessert Luftqualität
Gerade in größeren oder verwinkelten Ställen reicht das Lüften über Fenster und Tore allein aber oft nicht mehr aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie trotzdem genügend Frischluft in den Stall kommt.
So machen sich passive Lüftungen zunutze, dass warme Luft leichter ist als kalte und nach oben steigt. Diese verbrauchte Luft entweicht über eine Öffnung am Dach. Frischluftnachschub erfolgt beispielsweise durch seitliche Lüftungsschlitze im Stallgebäude. Beispiele für passive Lüftungen sind Lüftungsschächte oder Luft-Firste. Letztere sind oft aus durchsichtigem Material, sodass als angenehmer Nebeneffekt mehr Licht in den Stall gelangt (sogenannte Licht-Luft-Firste). Gerlinde Hoffmann, ehemalige Leiterin der Abteilung Umwelt und Pferdehaltung bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), gibt jedoch zu bedenken, dass für ein gutes Funktionieren der passiven Lüftung die Temperatur draußen etwa drei bis fünf Grad kälter sein muss als im Stall. Im Sommer könne dies zum Problem werden und zu einer Überhitzung im Stall führen – was eine zusätzliche Lüftungsmöglichkeit etwa durch Fenster erforderlich mache.
Windschutznetze vereinen reichlich Frischluft und Licht mit Schutz vor unwirklichen Wetterbedingungen. Sie sind kostengünstig und können ohne aufwendige Unterkonstruktion montiert werden, eine Nachrüstung ist daher meist problemlos möglich. Selbst große Flächen können mit ihnen bespannt werden. Windschutznetze bieten in der Regel eine hervorragende Sicht nach draußen. Möglich sind auch Wickellüftungen: Bei gutem Wetter werden die Windschutznetz-Fronten wie Rollos aufgewickelt, bei schlechtem Wetter bleiben sie unten und bieten Schutz.
Ventilatoren befördern frische Luft aktiv ins Stallinnere. Sitzen die Ventilatoren an den Zuluft-Öffnungen wird Frischluft in den Stall hinein- und verbrauchte Luft herausgedrückt (Überdrucklüftung). Ventilatoren an den Abluftöffnungen führen verbrauchte Luft nach draußen und ziehen durch den entstehenden Unterdruck frische Luft durch Lüftungsschlitze nach innen (Unterdrucklüftung). Sind sowohl Zu- als auch Abluftöffnungen mit Ventilatoren bestückt, spricht man von einer Gleichdrucklüftung. Übrigens: Die in der Rinderhaltung durchaus üblichen Deckenventilatoren sucht man in Pferdeställen (noch) vergeblich. Diese wälzen die Luft um und haben so einen leicht kühlenden Effekt – der zum Teil durch zusätzliche Wasser-Sprühvernebler noch verstärkt wird. Für Rinder ist das wichtig, weil sie empfindlicher auf Hitze reagieren als Pferde. Wenn die Sommer dank Klimawandel immer wärmer werden, könnten Deckenventilatoren auch Einzug in die Pferdeställe halten.
Schlauchlüftungen kommen ursprünglich aus dem Rinderstall. Vereinfacht erklärt wird Frischluft mit Ventilatoren angesogen und durch einen großen, durchgehenden Schlauch, der oberhalb der Pferdeboxen montiert ist, geleitet. Über regelmäßige Öffnungen im Schlauch gelangt die frische Luft direkt in die Boxen. Laut Hersteller kann dadurch eine dauerhafte Frischluftzufuhr ohne Zugluft gewährleistet werden. Wissenschaftler der Agrarforschung Schweiz haben im Jahr 2022 drei Lüftungssysteme genauer unter die Lupe genommen (Studie in französischer Sprache: Influence de trois différents systèmes de ventilation sur le climat d’écurie; https://doi.org/10.34776/afs13-225). Demnach konnte die Schlauchbelüftung gegenüber Decken- und Axialventilatoren am effektivsten die CO2-Konzentration im Stall senken. Sie sei besonders für längliche Stallgebäude, wie sie für die Einzelboxenhaltung typisch sind, empfehlenswert. Je nach Hersteller sind spezielle Zusatzfunktionen möglich, unter anderem: Kühlung im Sommer, (leichte) Heizung im Winter sowie das Vernebeln von ätherischen Ölen, Arzneimitteln oder Desinfektionsmitteln.
Stallklima-Check hilfreich
Beim Neubau eines Stalles wird in der Regel das Belüftungskonzept von vorneherein mit eingeplant. Doch auch für Altbauten gibt es Möglichkeiten, das Stallklima zu optimieren. Kompetente Beratung durch Fachleute, ob, und wenn ja, welche Lüftungsanlage Sinn macht, ist hier unerlässlich. Auch die Lüftungs-Firmen bieten meist einen Stallklima-Check an. Um selbst besser einschätzen zu können, wie es um das Stallklima im eigenen Stall bestellt ist, können Messgeräte zum Einsatz kommen: Beispielsweise Messgeräte für Lufttemperatur und -feuchtigkeit, Windmesser (Anemometer) für die Bestimmung der Luftbewegung oder Messgeräte beziehungsweise Sensoren für Schadgase (insbesondere CO2). Eine einfach durchführbare Bestimmung des Ammoniakgehaltes ist mit Teststreifen speziell für die Stallluft möglich.
Nicht nur Lüftung im Blick
Pferdehalter sollten sich jedoch nicht allein auf Lüftungskonzepte verlassen. Zwar ist eine gute Lüftung unabdingbar, ersetzt aber keinesfalls die „Grundregeln“ eines guten Stallmanagements: Gründliches Misten hält die Ammoniak-Konzentration im Stall gering, Heu und Einstreu von guter Qualität verhindern zu hohe Staub- und Keimbelastungen. Absolut rein wird die Luft im Pferdestall nie sein, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Vielmehr sollen „Staub- sowie Keimgehalt, relative Luftfeuchtigkeit und Schadgaskonzentrationen in einem Bereich gehalten werden, der für die Pferdegesundheit unbedenklich ist“, so die Leitlinien. Übrigens: Senkrechte Lüftungsschlitze, wie sie in modernen Boxentüren Standard sind, sorgen zwar für einen besseren Luftaustausch zwischen Box und restlichem Stallgebäude – wenn aber im gesamten Stall Mief herrscht, bringen auch diese Lüftungsschlitze nur wenig.
Frische Luft im Stall ist wichtig – Zugluft hingegen kann sich negativ auswirken. Dazu erklärt das BMELV: „Unter Zugluft versteht man einen Luftstrom, der kälter als die Umgebungstemperatur ist, im Vergleich zur herrschenden Luftbewegung eine hohe Luftgeschwindigkeit hat und nur partiell auf Körperteile auftrifft.“ Dieser kleinflächige Kältereiz bleibe von der Thermoregulation unbeantwortet. Allerdings scheinen Pferde bezüglich Zugluft unempfindlicher zu sein als Zweibeiner: „Ganz oder großflächig auf den Körper auftreffende Luftströmung ist für das Pferd keine Zugluft, auch wenn sie vom Menschen als solche empfunden wird“, heißt es in den Leitlinien. Vielmehr könne eine angepasste Luftströmung die Thermoregulation der Pferde unterstützen und sich positiv auf ihre Gesundheit auswirken.
Offenställe gelten als besonders pferdefreundlich, bieten den Pferden reichlich Bewegung, Licht und Luft. Doch in den Innenbereichen des Offenstalls ist eine gute Luftqualität nicht automatisch gesichert. Sind die Zugänge zum Liegebereich beispielsweise mit Folienvorhängen versehen, kann hier durchaus ein ungünstiges Stallklima entstehen. Halten die Pferde sich dort auf – zum Schlafen oder zum Unterstehen – atmen sie diese reizende Luft ein. Daher gilt für Offenställe: Stallklimaparameter der Innenbereiche checken und gegebenenfalls mittels geeigneter Lüftung verbessern.








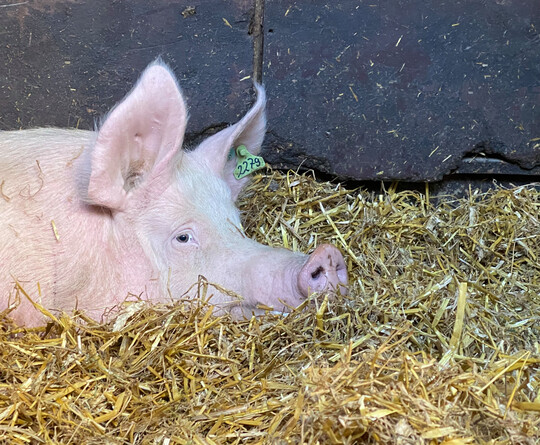

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.