
Instabile Nahrungsnetze
Der Verlust von häufig vorkommenden Arten kann Nahrungsnetze instabil machen, mit weitreichenden Folgen für ganze Ökosysteme und ihre Leistungen. Das zeigt eine neue Studie, die unter Leitung der Schweizer Forschungsanstalt WSL und der ETH Zürich durchgeführt wurde.
von age erschienen am 03.11.2025Gehen häufig vorkommende Arten in Schlüssellebensräumen wie Feuchtgebieten oder landwirtschaftlichen Flächen verloren, brechen regionale Nahrungsnetze ziemlich schnell zusammen. Das hat unter anderem zur Folge, dass Ökosystemleistungen wie die Bestäubung nicht mehr sichergestellt sind. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam unter Leitung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und der ETH Zürich in einer nun veröffentlichten Studie.
Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass nicht die seltenen, sondern die häufigen Arten den größten Einfluss auf die Stabilität der regionalen Nahrungsnetze haben. Würden häufig vorkommende Arten gezielt entfernt, stürzten sie auch andere Arten, die von ihnen abhingen, ins Verderben – ähnlich einem Dominoeffekt. Die häufigen Arten fungierten gewissermaßen als „Dreh- und Angelpunkt“ in einem Netzwerk, da sie sehr viele Verbindungen zu anderen Lebewesen hätten und oft in unterschiedlichen Lebensräumen vorkämen.
Besonders groß ist laut Studie der Einfluss von Feuchtgebietsarten. Obwohl Feuchtgebietsflächen in der Schweiz relativ klein und dortige Arten nicht zahlreich seien, habe ihr Aussterben zu signifikanten Veränderungen im Nahrungsnetz geführt, so die Erstautorin der Studie, Dr. Merin Reji Chacko. Erklären lasse sich das unter anderem damit, dass gerade Arten aus Feuchtgebieten öfter in mehreren Habitaten unterwegs seien und so an verschiedenen Orten zum Funktionieren der Ökosysteme beitrügen, etwa Libellen, die als Larven im Wasser lebten und als erwachsene Tiere an Land.
Das Forscherteam kommt zu dem Schluss, dass sich Schutzmaßnahmen nicht nur auf seltene Arten konzentrieren sollten, sondern verstärkt auch auf häufige Arten, die Schlüsselrollen in den Ökosystemen einnehmen. Das heiße aber nicht, dass die selteneren Arten im Naturschutz vernachlässigt werden könnten. Ebenso entscheidend sei der Erhalt eines Mosaiks von vielfältigen Lebensraumtypen, die nebeneinander vorkämen. Viele Arten nutzten mehrere Habitate und transportierten zwischen ihnen Energie und Nährstoffe. Generell müssten Schutzstrategien künftig stärker über Art- und Habitatsgrenzen hinweg gedacht werden, um die Biodiversität längerfristig zu erhalten.
Im Rahmen ihrer Untersuchung erstellten die Forscher ein „Metaweb“, ein komplexes Netzwerk mit mehr als 280.000 Fressbeziehungen zwischen rund 7800 Arten von Pflanzen, Wirbeltieren und Wirbellosen. Auf Basis dieser Daten simulierten sie dann den Verlust von Arten aus verschiedenen Lebensraumtypen.




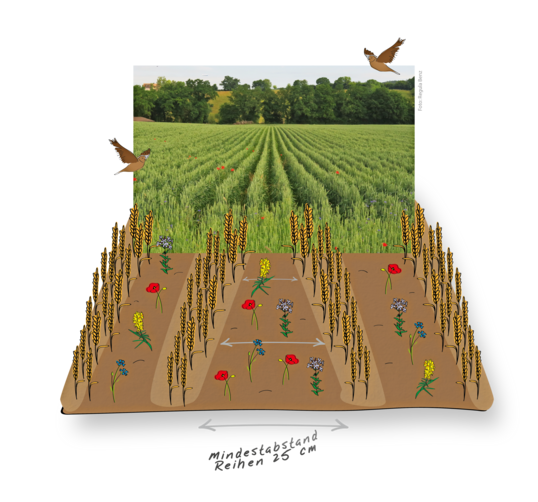





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.