Was läuft bei der Düngung in Baden-Württemberg?
Die Halle in der Distelhäuser Brauerei war voll. Kein Wunder, denn es bewegt die Landwirte, worauf sie sich im nächsten Jahr einstellen müssen. "Düngung in Baden-Württemberg - geltendes Recht und zukünftige Vorgaben“ hieß der Titel der Vortrags- und Diskussionstagung, zu der der Landesbauernverband (LBV) mit den Kreisbauernverbänden Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis eingeladen hatten.
- Veröffentlicht am

Referenten von Ministerium für Ländlichen Raum (MLR), Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) und der BGD-Bodengesundheitsdienst GmbH informierten über den neuesten Stand, bewerteten die Auswirkungen und dachten über neue Strategien nach.
Das Unverständnis der Landwirte über die erneute Verschärfung der Düngeverordnung formulierte Reinhard Friedrich, Vorsitzender des mit einladenden Bauernverbands Main-Tauber-Kreis. Annette Herbster, Referentin des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg (LBV) führte durch die Veranstaltung. In der Düngediskussion sei vieles durcheinander gegangen und man wolle nun mit dieser Veranstaltung "Licht ins Dunkel" bringen, auch wenn hier Dinge verkündet werden müssen, die nicht jeder hören wolle.
Landwirte in BW erfüllen schon viele Vorgaben
Dr. Helga Pfleiderer, Düngeexpertin am MLR kann den Ärger der Landwirte verstehen. Das ändert aber nichts daran, dass die verschärfte Düngeordnung 2020 kommen wird und das "ohne großen Spielraum". Mit einem Blick in die Historie zeigte sie, dass die Bundesregierung die Anforderungen über lange Jahre offensichtlich nicht mit dem notwendigen Ernst versucht hat in Gesetze zu fassen mit dem Ergebnis, dass sie jetzt rasch liefern muss. Pfleiderer legte Wert darauf, den Zuhörern nahezubringen, dass Landwirte in Baden-Württemberg an vielen Stellen schon auf dem erforderlichen Stand sind oder nahe dran. In anderen Bundesländern sieht es anders aus. Das schließt aber auch nicht aus, dass einzelne Landwirte sich stärker umstellen müssen als andere.
Nicht einfach zu durchschauen
Nährstoffbilanz und Stoffstrombilanz waren Thema von Tobias Mann vom LTZ. Er ging detailliert darauf ein, welcher Betrieb eine Stoffstrombilanz erstellen müsse und warum oft gravierende Unterschiede in den Werten der Stoffstrombilanz und der Nährstoffbilanz bestehen. Sehr genau legte er die diffizile Berechnung für Biogasanlagenbetreiber dar. Wenn alles einmal in die Systeme eingetragen sei, werde es einfacher, tröstete er.
Versorgungsgrad von Nährstoffen guter Böden nimmt ab
Die EUF-Methode der Bodenuntersuchungen erläuterte Dr. Gebhard Müller, BGD-Bodengesundheitsdienst GmbH. Bei der Versorgung der Böden an P und K sei zu beobachten, dass der Versorgungsgrad bei guten Böden (D und E) in Baden-Württemberg abgenommen habe, der von schlechteren Standorte sich erhöht habe. Vor allem in die in den "roten Gebieten" geforderte Reduzierung der Düngung um 20 % schränke den Ertrag und vor allem den Rohproteingehalt von Weizen stark ein. Als Ratschläge zum Umgang mit der neuen Düv gab er folgende Anregungen:
- Bei Winterweizen lieber eine Stufe geringer planen und dafür bestimmte Sorten anbauen, die sicher abgenommen werden
- Zwischenfruchtmischungen einsetzen mit dem Ziel der N-Sicherung und Aktivierung des Bodenlebens
- Ca-Versorgung beachten.
- Verbauung des Bodens forcieren: 20 bis 100 kg N/ha und a kann so mobilisiert werden
- Bei P – teilflächenspezifische Beprobung und Verteilung
- Düngefehler vermeiden, kein Rausdüngung aus der Fläche und auch innerhalb der Fläche auf gleichmäßige Verteilung achtenGebietswasserkörper, oft macht ein Brunnen das Gebiet rot
- Düngung und Bewirtschaftungsweise betrachten – der Umbruch von Grünflächen setze N frei.



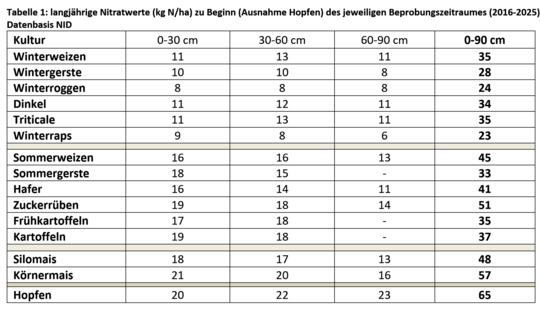


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.