In großer Sorge um den Pflanzenschutz
Immer weniger Wirkstoffe, immer strengere Auflagen und oft nur noch Notfallzulassungen, insbesondere in Kulturen mit geringem Flächenumfang – die Obstbauern machen sich große Sorgen um den Schutz ihrer Anlagen. Das machten sie Bundes- und Landtagsabgeordneten bei einem Hofgespräch auf dem Betrieb von Thomas Heilig in Ravensburg-Bavendorf deutlich. Veranstaltet wurde es von der Obstregion Bodensee zusammen mit dem Industrieverband Agrar (IVA).
- Veröffentlicht am

Nicht nur explodierende Kosten und völlig unzureichende Erzeugerpreise lösen bei den Obstbauern zunehmend Existenzängste aus. Auch die wachsende und teils völlig unsachliche Kritik am chemischen Pflanzenschutz, die immer häufiger in persönliche Anfeindungen mündet, setzt den Obstbauern zu. Leistungen der Praxis für die Biodiversität aber werden nicht oder viel zu wenig beachtet. Wie sehr diese Schieflage die Obstbauern belastet, machten sie in Gesprächen mit den zahlreich erschienen Abgeordneten deutlich.
Resistenzen und Bekämpfungslücken nehmen zu
„Angesichts der derzeitigen Lage ist teils von Verzweiflung zu hören“, berichtete auch IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer. Er sieht die Pflanzengesundheit auf der Kippe, auch wenn die Dramatik bei vielen Kulturen derzeit erst bei Schaderregern erkennbar ist. Dabei betonte er, dass die Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel allein nicht ausschlaggebend sei. Im Gegenteil: Sie führe zu teils falschen Schlussfolgerungen. Vielmehr setze sich der Wirkstoffverlust fort, mit der Folge von Resistenzen und Bekämpfungslücken. So blieben von den ursprünglich 900 Wirkstoffen vor zehn Jahren noch 400 Wirkstoffe übrig. Dauerhaft werden seiner Prognose zufolge nach 2030 wohl nur 150 Wirkstoffe verfügbar sein. Dazu kommen Einschränkungen bei der Anwendung wie Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit oder Wartezeiten bis zur Ernte.
Immer mehr Notfallzulassungen
Gemmer geht davon aus, dass es in Zukunft nicht mehr für alle Kulturen zugelassene Pflanzenschutzmittel geben wird. Bereits in den letzten Jahren sei die Zahl der Anträge auf Notfallzulassung deutlich angestiegen, wobei allein auf den Obstbau 52 Prozent entfielen. „Die Rettung von Wirkstoffen über diesen Weg ist keine Lösung, zumal von den 135 Anträgen nur rund 60 positiv beschieden wurden“, meinte er und fordert von der Gesetzgebung klare Rahmenbedingungen für den chemischen Pflanzenschutz zu schaffen. Auch für die Forschung nach neuen Wirkstoffen biete die Notfallzulassung keine wirtschaftliche Basis.
Sollte der Verlust an Wirkstoffen anhalten, fürchtet der IVA-Hauptgeschäftsführer, dass die Produktion zum Teil in andere Länder abwandert und mehr Nahrungsmittel importiert werden müssen. Ob dies gewollt sei angesichts der Probleme mit Lieferketten und einer wachsenden Abhängigkeit von Exportländern stellte er aber in Frage.
In Hoffnungsträgern wie biologischen Pflanzenschutzmitteln oder Biostimulanzien sieht er keine Alternative, weil auch für die Biomittel die hohen Zulassungshürden greifen und sich auch dort bereits Wirkstoffverluste abzeichnen. Biostimulanzien, die als Düngeprodukt gelistet sind, umfassen zwar ein breites Spektrum an Substanzen. Sie wirken aber meist über eine verbesserte Nährstoffverwertung oder Stresstoleranz und nicht über die direkte Abwehr von Krankheiten und Schädlingen. Deshalb seien insbesondere für den weiterentwickelten integrierten Pflanzenschutz weiterhin chemische Mittel erforderlich, eine Kombination mit vorbeugenden, physikalischen, biotechnischen und biologischen Maßnahmen langfristig sinnvoll. „Wir brauchen Zeit und keine Verbote“, unterstrich Gemmer.
Massive Kritik übte er an dem Verordnungsentwurf der EU zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR-Richtlinie). Ziel dieses Entwurfs ist es, bis 2030 die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent zu reduzieren und deren Einsatz in sensiblen Gebieten ganz zu verbieten. Baden-Württemberg mit seinem hohen Anteil an Schutzgebieten wäre davon besonders betroffen. „Wenn das so kommt, wäre das eine Katastrophe“, machte er deutlich, wobei er angesichts des sich abzeichnenden Widerstands von einem langjährigen Gesetzgebungsverfahren mit zähen Verhandlungen ausgeht. Im Gegenzug plädierte er für klare Anwendungsgebote für Pflanzenschutzmittel in Kombination mit modernen Maßnahmen und Technologien.
Verständnis für den Pflanzenschutz fehlt
Auf die Notwendigkeit, Pflanzen zu schützen, um gesunde Nahrungsmittel zu erzeugen und die heimische Produktion zu erhalten, verwies Dr. Christian Scheer vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB). Er beklagte, dass der Bezug und das Verständnis für den Pflanzenschutz in der Gesellschaft vielfach verloren gegangen sei angesichts voller Ladenregale und Nahrungsmittel im Überfluss. Dabei sei gerade der Integrierte Pflanzenschutz eine tolle Entwicklung gewesen, die in den 1990er Jahren in der Praxis Einzug hielt. Dieser basiere auf mehreren Säulen, bei denen Schadschwellen beachtet, Nützlinge eingesetzt, biotechnische Verfahren angewendet und erst dann chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Beispielhaft verwies er auf die Bekämpfung des Apfelwicklers, bei dem durch die Anwendung des Granulosevirus und der Verwirrung der Insektizideinsatz reduziert werden konnte. Allerdings sei die Anwendung an eine Mindestgröße der Fläche gebunden und verursache höhere Kosten. Außerdem bestehe bei alleinigem Einsatz des Granulosevirus die Gefahr der Resistenzentwicklung, was im Bioanbau bereits zu beobachten sei. Deshalb sei ein Wirkstoffwechsel wichtig.
Scheer machte auch deutlich, dass die Integrierte Produktion kein statisches System ist, sondern stetig weiterentwickelt wird, wobei beispielsweise widerstandsfähige Sorten einbezogen oder biologische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Er plädierte dafür, keine Verbote ohne Alternativen auszusprechen und chemische Wirkstoffe als Brückentechnologie zu nutzen. Dabei verwies er auf das baden-württembergische Biodiversitätsstärkungsgesetz, bei dem die Reduktion chemischer Mittel um 40 bis 50 Prozent bis 2030 nicht durch Verbote, sondern durch eine intensivere Forschung und mit Einbezug der Praxis erreicht werden soll. Dadurch konnte eine ganze Reihe von Forschungsprojekten angestoßen werden.
Einsatz selektiver Mittel
Wie sehr sich der Pflanzenschutz in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, machten die beiden Obstregionsvorsitzenden Thomas Heilig und Erich Röhrenbach deutlich. Die einstige Terminbehandlung mit breitwirksamen Mitteln gehört längst der Vergangenheit an. An ihre Stelle ist der auf Schadschwellen basierende Einsatz selektiv wirkender Mittel getreten. Die beiden Vorsitzenden sind überzeugt, dass chemischer Pflanzenschutz dennoch nötig ist. „Die Made in der Zwetschge wird der Verbraucher nicht akzeptieren, doch wichtige Mittel, um den Befall durch Pflaumenwickler zu verhindern, werden fehlen“, bedauerte Heilig den zunehmenden Wirkstoffverlust. Wenn heute das Wort Pflanzenschutz falle, sei es meist negativ besetzt. „Doch wir wollen unsere Pflanzen schützen, um ausreichend und gesunde Nahrungsmittel zu produzieren“, betonte er weiter.
Leistungen der Praxis nicht gewürdigt
Auch Leistungen der Obstbauern für mehr Biodiversität würden in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen. So konnten durch Wildbienennisthilfen, Blühflächen und Gehölzpflanzungen die Zahl der Wildbienenarten in der Bodenseeregion seit 2010 fast verdoppelt werden, was wissenschaftlich belegt ist. Und dies trotz chemischem Pflanzenschutz. Dagegen würden Studien wie die Krefeld-Studie zum Insektenschwund wenig oder gar nicht hinterfragt. Beispielsweise basiere diese Erhebung auf dem Fang mit Malaisefallen, womit nur fliegende Insekten erfasst werden. Heilig kritisierte in diesem Zusammenhang, die Ursachensuche für den Rückgang an Biodiversität allein dem chemischen Pflanzenschutz anzulasten, während mögliche andere Faktoren wie die Lichtverschmutzung oder die Zunahme des Mobilfunks ausgeblendet würden.
„Wir müssen wirtschaftlich arbeiten, um am Ende verkaufsfähige Früchte zu haben. Wir wollen aber auch den Pflanzenschutz reduzieren, wo dies möglich ist, um nicht immer an den Pranger gestellt zu werden“; machte Erich Röhrenbach deutlich. Deshalb habe die Obstregion zwei Modellanlagen mit robusten Apfelsorten angelegt, anhand derer das Einsparpotenzial von Pflanzenschutzmitteln überprüft wird. „Aber eine Reduktion wird nicht von heute auf morgen möglich sein. Wir brauchen für belastbare Ergebnisse drei bis fünf Jahre, sonst wäre das Risiko zu groß“, warb Röhrenbach für Geduld.






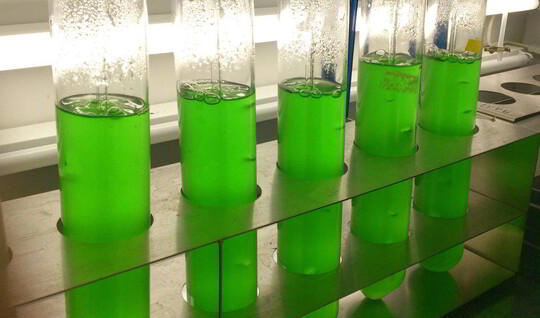


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.