Schweinezüchter wollen bei Tierwohl und Tierschutz mitreden
Fragt man Verbraucher, wünschen sie sich Ställe, in denen die Schweine mehr Platz und einen Auslauf haben. Fragt man Schweinehalter fürchten die auf den Kosten für solche Tierwohlställe sitzen zu bleiben. Wie sich die unterschiedlichen Interessen künftig unter einen Hut bringen lassen, darüber diskutierten am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche gut zweihundert Teilnehmer auf den von SZV/German Genetic, den Kreisbauernverbänden (KBV) Biberach-Sigmaringen, Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems sowie BWagrar initiierten Fachtagungen in Laupheim (Landkreis Biberach) und Untermünkheim-Übrigshausen (Landkreis Schwäbisch Hall).
- Veröffentlicht am

Ob es die betäubungslose Ferkelkastration, das Schwänze kupieren oder das Kastenstandurteil sind: Die Anforderungen an schweinehaltende Betriebe steigen, viele Betriebsleiter fühlen sich von der Tierschutz- und Tierwohl-Debatte inzwischen regelrecht gegängelt und wünschen sich einen Austausch, der die Sichtweise der jeweils anderen Partei zulässt, der auf Fakten setzt und teils auf beiden Seiten überbordende Emotionen und Ideologien gegen Argumente ersetzt.
„Wenn wir in mehr Tierwohl in unseren Ställen investieren, bekommen wir unter Umständen schnell Probleme mit dem Baurecht“, beschreibt Hans-Benno Wichert, Vorsitzender von SZV/German Genetic und Vizepräsident des Landesbauernverbandes (LBV) das gegenwärtige Dilemma und fügt hinzu: „Das interessiert die Befürworter von mehr Platz in den Ställen im Normalfall allerdings nicht.“
Gespräche mindern Vorbehalte
Umso wichtiger sei es, da waren sich berufsständischen Vertreter und Referenten auf den Fachtagungen einig, mit Verbrauchern und Tierschutzorganisationen ins Gespräch zu kommen, und bei der langen Liste an Forderungen für mehr Tierwohl klarzustellen, dass es dabei auch um die bäuerlichen Familien, deren Einkommen und Existenz gehen müsse, zumal regional erzeugtes Schweinefleisch in der öffentlichen Debatte ganz oben auf der Agenda stehe, wie Wichert darlegte.
Konventionelle Betriebe würden heute schon per se fälschlicherweise als Tierquäler gebrandmarkt, gab Martina Magg-Riedesser, Vorsitzende der Fachgruppe Schweine beim Kreisbauernverband (KBV) Biberach-Sigmaringen in ihrem Grußwort zu bedenken Solchen Vorurteilen müsse man mit Argumenten entgegen treten und darauf verweisen, dass es mehr Tierwohl nicht für umsonst gebe.
„Wer soll die tollen Großbuchten bei diesen Auszahlungspreisen bezahlen“?, fragte die Schweinehalterin in die Runde und erntete dafür Beifall. Sich darüber zu beklagen, nütze dem Einzelnen jedoch wenig, „erreichen können wir nur gemeinsam etwas“, appellierte sie an ihre Berufskollegen, sich an der öffentlichen Diskussion zu beteiligen.
Denn vieles, das wurde an diesem Nachmittag in dem vollbesetzten Saal im Gasthof „Schützen“ klar, dürfte bisher nur wenig in die Öffentlichkeit gelangt sein, beispielsweise, dass die Zucht verstärkt auf Resistenzmerkmale setzt, Schweine züchtet, die gegen Coli-Bakterien immun sind und die mit einer PRRS-Infektion besser zurecht kommen, wie Albrecht Weber, Zuchtleiter bei SZV/German Genetic, erläuterte. Auch das ein Beitrag zu mehr Tierwohl, Robustheit, weniger Verlusten und Ressourcen bei den Tieren.
Individueller Gesundheitsschutz
Wie folgenreich der Gesundheitsstatus der neugeborenen Ferkel für die Betriebe sein kann, damit setzte sich Dr. Matthias Eddicks von der Klinik für Schweine an der Ludwig-Maximilians-Universität in seinem Vortrag zur Balance zwischen Bestandsgesundheit und Erregerdruck auseinander. „Halten Sie Ihre gesund geborenen Ferkel gesund“, appellierte der Schweinefachtierarzt und Wissenschaftler an die zahlreichen Züchter, Ferkelerzeuger und Mäster im Saal.
Eine nicht ganz einfache Aufgabe, denn die Jungtiere sind naturgemäß einem hohen Infektionsdruck ausgesetzt und erkranken in ihren ersten Lebenswochen häufiger als später die erwachsenen Schweine. Umso wichtiger sei es, die Ferkel vor den zahlreichen „Kinderkrankheiten“ zu schützen, um dadurch auf die ansonsten nötigen Antibiotikagaben verzichten zu können.
Vorbeugenden Schutz vor Erregern bieten Impfungen. Allerdings nur dann, das machte Eddicks deutlich, wenn die Jungtiere zum richtigen Zeitpunkt geimpft und zuvor ein für den Bestand passendes Impfkonzept mit dem Hoftierarzt erarbeitet worden ist. „Hierzu zählt übrigens auch die Impfung der Sauen“, machte der Tierarzt deutlich. Bedingt durch die hohen Remontierungsraten, falle die Immunität der Sauen oftmals niedriger aus als erwartet. Ein Risiko für die Ferkel dieser Muttertiere, die Gefahr laufen, schon infiziert auf die Welt zu kommen.
Ziel müsse es deshalb sein, so wenig Erreger wie möglich im Bestand zu haben und ihre Verbreitung so gut wie möglich zu verhindern. Damit das gelingt, sollte man auch zugekaufte Jungsauen im Augen behalten, sie in Quarantäne aufstallen und in das auf dem Betrieb entwickelte Impfkonzept einbinden.
Tiersignale frühzeitig erkennen
Ein Auge auf die Tiere, auf deren Signale, dazu rät Mirjam Lechner von der Unabhängigen Erzeugergemeinschaft (UEG) Hohenlohe-Franken. Aus gutem Grund, wie die Diplom-Agraringenieurin und Verhaltensexpertin deutlich machte. Seit zwei Jahren betreut sie ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt, das Schweinehalter darin unterstützt, die Signale, die die Tiere aussenden, rechtzeitig zu erkennen, zu verstehen und für die Abläufe in den Herden zu nutzen.
Geplant ist hierfür ein Ampelsystem fürs Handy. Ein Klick genügt, um dann auf den dort hinterlegten Beispielbildern vergleichen zu können, wie fit und gesund die eigenen Schweine sind oder ob die Ampel bei Tierwohl und Tiergesundheit auf rot steht. „Wenn ich die Signale der Tiere verstehe, kann ich darauf reagieren“, macht Lechner deutlich. Der einseitige Blick auf das Haltungssystem, Fütterung oder Genetik reiche nicht aus, um die Schweine vor Krankheiten und Leistungsabfall zu schützen.
Vielmehr handele es sich um ein komplexes Gefüge, bei dem verschiedene Faktoren ineinander greifen. Konkret: Einstreu in den Buchten schützt nicht automatisch vor Schwanzbeißen. Allerdings schädigen kalte oder zu warme Liegeflächen, schlechte Luft, Wasser- und Rohfasermangel sowie zuviel Nährstoffe in den Rationen die Magen-Darm-Stabilität. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten: Die Darmwand wird brüchig, das Risiko, dass das Gewebe an Ohren und Schwänzen (Nekrose) abstirbt, steigt. „Je früher man erkennt, dass mit den Tieren etwas nicht stimmt, kann man gegensteuern, mit Raufutter für die Darmgesundheit oder Beckentränken für die Wasseraufnahme.
Zuvor hatte Dr. Beate Schumann von der Besamungsunion Schwein über die Herausforderungen berichtet, in einem engen werdenden Wettbewerb zwischen den Stationen mit Qualität und Service bei den Kunden zu punkten.
Zum Abschluss des Nachmittages führte Birgit Arnsmann von der Andreas Hermes-Akademie in Bonn in die Kunst einer gelungenen Kommunikation ein. Eine wichtige Voraussetzung: Seinem Gesprächspartner mit Toleranz und Wertschätzung begegnen. Nur dann könne man die Schnittstellen finden, um sich auf sein Gegenüber einzulassen und ihm in einer lösungsorientierten und positiven Sprache Fragen zu stellen.











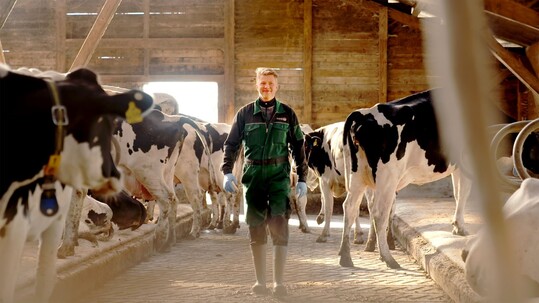
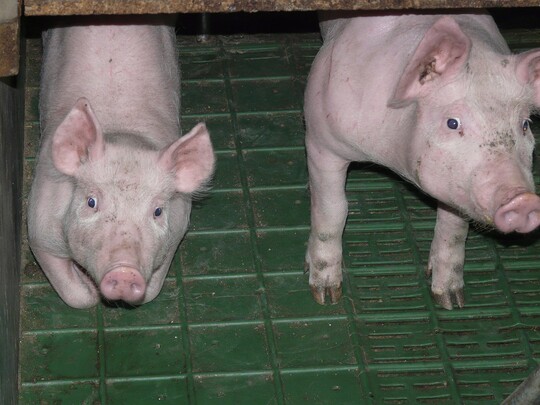



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.