Nicht zu kalt und nicht zu warm
Wie sich spontane Temperaturwechsel auf die Gesundheit von Kälbers, besonders auf deren Atemwegsorgane auswirken, zeigt eine bereits 2002 veröffentlichte wissenschaftliche Studie von Prof. Dr. Petra Reinhold und S. Elmer. Titel der Arbeit: "Die Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen der Umgebungstemperatur auf den Kälberorganismus". Veröfefntlicht wurde die Forschungsarbeit in der tierärztlichen Wochenschrift 109 (Seiten: 193-200). Am besten kommen die Jungtiere demzufolge mit gemäßigten, gleichbleibenden Temperaturen klar.
- Veröffentlicht am

Erforscht wurde das Temperaturbefürfnis der Kälber in einem Versuch mit drei Gruppen klinisch gesunder Jungtiere. Vier Stunden lang wurden sie spontan drei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen ausgesetzt. Alle Kälber waren zuvor bei einer Umgebungstemperatur von 18 bis 20 Grad gehalten worden. In der Kontrollgruppe wurde dieser Temperaturbereich nicht verändert.
Die Kälber in Gruppe zwei wurden einer niedrigen Temperatur, in diesem Fall einer Umgebungstemperatur von plus fünf Grad ausgesetzt. Die dritte Gruppe verbrachte vier Stunden bei einer Temperatur von plus 35 Grad. In allen drei Buchten betrug die relative Luftfeuchtigkeit 60 Prozent.
Mit Kälte kommen Kälber besser zurecht als mit Hitze
Die Kälber, die der niedrigen Temperatur von plus fünf Grad ausgesetzt wurden, reagierten äußerlich mit einer verlangsamten, aber tieferen Atmung. Damit hielten die Tiere den Gasaustausch konstant und verringerten die Wärmeabgabe. Zudem zitterten einige Kälber. Dmit versuchten die Kälber, Wärme zu gewinnen. Ihre Körpertemperatur konnten die Tiere konstant halten.
Die Kälber, die sich mit der heißen Umgebung von plus 35 Grad auseinandersetzten mussten, atmeten flach und hechelnd. Damit versuchten die Tiere, den Gasaustausch konstant zu halten und gleichzeit mehr Wärme abzugeben. Ihre Körpertemperatur stieg in den fiebrigen Bereich an. Ein Zeichen dafür, dass die thermoregulatorischen Mechanismen der Kälber in diesem Fall nicht mehr ausreichten.
Die Autoren schlussfolgerten damals, dass die Tiere bei einer längeren Verweildauer unter diesen Bedingungen vermutlich einen hitzebedingten Zusammenbruch erlitten hätten. In den folgenden 21 Tagen verendeten zwei Kälber aus der Kälte- und ein Kalb aus der Hitzegruppe. Der Grund: Schwere Atemwegserkrankungen. Sektionen der Kälber am 21. Tag nach dem vierstündigen Aufenthalt in den verschiedenen Temperaturbereichen erbrachten weitere Aufschlüsse über den Gesundheitszustand der Kälberlungen.
Die Kälber der Kontrollgruppe wiesen keine Lungenerkrankungen auf. Bei den vier Stunden unter kalten und heißen Bedingungen gehaltenen Kälbern kam es jedoch in erheblichem Umfang zur Infektionen der Lungen mit unterschiedlichen Erregern. Den Schweregrad der Infektionen beziehungsweise den Anteil der betroffenen Lungenbereiche zeigt die Übersicht.
In der unter kalten Bedingungen gehaltenen Gruppe zeigten zwei Drittel der Kälber keine Lungenveränderungen, ein weiteres Drittel jedoch Erkrankungen mit mehr als 50 Prozent pneumonisch veränderten Lungenabschnitten. In der Gruppe, in der die Kälber Hitzestress ausgesetzt waren, blieben nur 30 Prozent der Tiere gesund. Die Hälfte zeigte vereinzelte Pneumonieherde im Bereich der Spitzenlappen. Bei 20 Prozent wurden ebenfalls pneumonische Veränderungen in den Lungen von über 50 Prozent gefunden.
Die Studie zeigt, welche Auswirkungen schnell wechselnde Temperaturen auf die Lungengesundheit von Kälbern haben können. An niedrige Temperaturen können sich Kälber leichter gewöhnen, wenn sie sich nicht spontan entwickeln und die Tiere mit ausreichender Energie versorgt sind.
Im Sommer benötigen Kälber Schattenplätze
Hohe Temperaturen stellen für Kälber ein vergleichsweise größeres Risiko dar, weil die körpereigenen Mechanismen, die höhere Temperaturen kompensieren können, begrenzt sind. Kälber sollten darum im Sommer immer die Möglichkeit haben, einen Schattenplatz aufsuchen zu können. Mit entsprechend überdachten Igluplätzen ist das möglich. Die Iglus schaffen zudem auch im Winter das nötige Kleinklima.
Die Iglus, so die Studieninitatoren, sollten hierfür auf jeden Fall einen Auslauf besitzen, damit die Kälber die Möglichkeit haben, ihren Standort zu wechseln. Für ältere Kälber gilt das Gleiche. Für sie können in Gruppenbuchten durch seitlich geschlossene Trennwände und einer Abdeckplatte im hinteren Buchtenabschnitt Kälbernester geschaffen werden, die den gleichen Zweck wie die Einzeliglus erfüllen und den Tieren die Möglichkeit bieten, sich einen Kleinklimabereich zu schaffen.
Zu diesem Themenkomplex gehört auch das Phänomen der Sommergrippe. Sie entsteht hauptsächlich dann, wenn Kälber starken Tag-Nacht-Temperatur-schwankungen ausgesetzt sind. Nicht selten entsteht an heißen Tagen ein großer Temperatursprung zur Nacht. Auch diese Schwankungen können Kälber häufig nicht ausreichend kompensieren und es kommt zu Atemwegserkrankungen. Aus diesem Grunde ist es in Gruppenboxen mit einem Kälbernest wichtig, dass die schützenden Abdeckplatten auch im Sommer immer abgesenkt bleiben. Sie sollten ausschließlich zum Entmisten hochgezogen werden, die übrige Zeit sollten sie in waagerechter Position stehen bleiben.



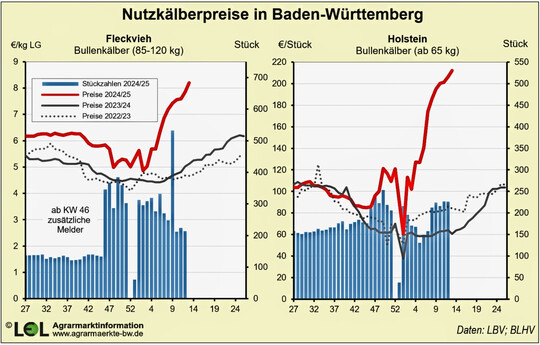






Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.