Den Schutz von Pflanzenschutzmitteln empfohlen
Die Ernennung des Neckar-Odenwald Kreises zur Bio-Musterregion sei unter Mitwirkung des 1 126 Mitglieder zählenden Kreisbauernverbandes zustande gekommen. Die konventionelle Landwirtschaft soll dabei aber nicht gegen die Bio-Landwirtschaft konkurrieren. „Beides ergänzt sich und beides wird benötig“, sagte Vorsitzender Albert Gramling.
- Veröffentlicht am

Ein wichtiger Baustein sei, die Vermarktung von Bioprodukten zu fördern. Dagegen fördert das negative Image und Stimmungsmache in der Gesellschaft gegenüber dem Pflanzenschutz den weiteren Verlust von Wirkstoffen. Mit dieser Aussage verwies der Vorsitzende auf den Hauptredner, Dr. Andras Maier vom Karlsruher Regierungspräsidium. Der Sachgebietsleiter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz schlüsselte vor den Mitgliedern und Gästen der Bauerversammlung in Seckach die Probleme speziell im chemischen Pflanzenschutz detailliert auf. Doch machte er den Landwirten keine Hoffnung, dass sich das Wirkstoffangebot verbessern könnte.
Nutzen mehren und das Risiko mindern
Dr. Maier plädierte für eine stärkere Besinnung auf die ackerbaulichen, biologischen und vorbeugenden Maßnahmen. Beim Pflanzenschutz gehe es letztendlich darum, den Nutzen zu mehren und das Risiko zu mindern. Er glaubt aber nicht, dass in Zukunft dabei alles öko sein wird. Am Ende muss der Landwirt von seiner Arbeit leben können. Deshalb wünscht sich der Referent vor allem praktikable Lösungen und eine Versachlichung der Diskussion.
Maier kritisiert die Herabsetzung der Rückstandswerte durch den Lebensmitteleinzelhandel (LEH), die unterhalb den Vorgaben von offiziellen Stellen liegen, was vor allem bei Obst und Gemüse vorkommt. Durch dieses „zweite Zulassungssystem“ werden Produkte aus deutscher Produktion gegenüber ausländischer Ware klar benachteiligt und das Zulassungssystem konterkariert. Als Folge davon wird von den Landwirten eher ein breit wirksamer Stoff eingesetzt. Auf diese Weise könnten die Vorgaben leichter eingehalten werden als über verschiedene, spezifisch wirksame Wirkstoffe. Oft wird noch vor dem Erreichen der Schadschwelle behandelt, um die Rückstände bei der Ernte zu minimieren.
Als Beispiel für das Diktat der Hersteller nannte Maier das Glyphosat-Verbot, das die Goldsteig-Käserei gegenüber ihren Milchlieferanten ausgesprochen hat. Damit will der Hersteller nach eigenen Angaben dem Wunsch der Verbraucher nachkommen und einen wichtigen Schritt in Richtung Kundenorientierung machen. Maier fragt sich, wer diesen Verbraucherwunsch herausgefunden hat.
Insgesamt wird die Wirkstoffpalette für den Pflanzenschutz enger, prophezeite der Experte. Es gibt kaum neue Wirkstoffe und vor allem kaum neue Angriffspunkte für die Pflanzenschutzmittel, so seine Begründung. Das Problem, neue Wirkstoffe zu finden, liegt an deren hohen Anforderungen nach hoher Wirksamkeit und zugleich möglichst geringer Umweltbelastung. „Zwei Kriterien, die sich gegenseitig nahezu ausschließen“, bemerkte Maier.
Neue Wirkstoffe nur noch für weit verbreitete Kulturen
Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Studien sehr stark angestiegen. Vor allem stellt das Umweltbundesamtes zu den Auswirkungen auf den Naturhaushalt immer höhere Anforderungen. In der Summe bedeutet das insgesamt Kosten von 200 bis 250 Mio. Euro für die Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels.
Während früher etwa 10.000 Substanzen untersucht wurden, bis ein Wirkstoff gefunden war, geht es heute in Richtung 100.000 Substanzen. Dr. Maier machte den Landwirten daher wenig Hoffnung, dass künftig viele neue Wirkstoffe auf den Markt kommen. Diese würden sich für die Industrie ohnehin nur noch für die weltweit großen Kulturen Weizen, Mais, Sojabohnen und Baumwolle rentieren. Weil zudem für viele Mittel die Zulassung ausläuft, werde die Anzahl der Wirkstoffe in den nächsten Jahren weiter schwinden.
Von einstmals rund 800 Wirkstoffen sei man jetzt bei 250 angelangt. Darunter sind die neuen Wirkstoffe schon enthalten, die uns irgendwann auch verloren gehen“; warnte Maier. Deshalb sollten die momentan vorhandenen Wirkstoffe gut geschützt werden.
Bei Glyphosat entscheidet Gesellschaft mehr als Zulassungsbehörde
Ausführlich ging der Pflanzenschutzfachmann auf das umstrittene Glyphosat ein, dessen ursprüngliche Bezeichnung Glycinphosphonat war und in den Sechzigerjahren für die Wasserenthärtung entwickelt worden ist. Als Blattherbizid hat das Mittel für die Landwirtschaft Bedeutung gewonnen, weil es systemisch bis in die Wurzeln und nicht über den Boden wirkt. Seine Wirkung gegenüber hartnäckigen Wurzelunkräuter wie Quecke, Distel oder Winde nannte Maier hervorragend. Ausgebrachtes Saatgut läuft dennoch auf.
Glyphosat blockiert in den Pflanzen die Bindung von drei aromatischen Aminosäuren, die allein Pflanzen mit Hilfe eines Enzyms herstellen können. Dieses Enzym besitzen nur Pflanzen und fehlt allen Warmblütern. Deshalb ist das Mittel laut Maier für den Menschen relativ ungefährlich und wirkt auch nicht bei Tieren.
Zur Krebsgefahr von Glyphosat erklärt Dr. Maier, im Pflanzenschutz sei das Risiko zu bewerten und nicht nur von der möglichen Gefahr auszugehen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kommt zum Schluss, dass Glyphosat nach den Vorgaben und der Zulassung nicht krebserregend ist.
Dennoch werde die Begrenzung der eingesetzten Wirkstoff-Mengen allein wegen des gesellschaftlichen Drucks nicht zu vermeiden sein, meint Maier. Dieser Druck, so befürchtet er, werde noch weiter zunehmen. Nicht nur von Seiten der Hersteller, des Handels oder Naturschutzbundes, auch durch die Gemeinden und über Pachtverträge. Doch Pestizidfreiheit bedeute auch frei von Kupfer, Schwefel und andere im Ökolandbau verwendeter Substanzen. Von momentan in Deutschland 30.000 Tonnen eingesetzten Pflanzenschutz-Wirkstoffen im Jahr entfallen 5000 bis 6000 Tonnen auf Glyphosat. Davon gehen 40 Prozent in die Vorsaat-Anwendung. Mit weiteren 40 Prozent wird die Stoppelbearbeitung eingespart und rund zehn Prozent kommen im Obst- und Weinbau zum Einsatz.
Gegen Resistenzen hilft weniger oft mehr
Am Beispiel des Getreidehähnchens schilderte Maier die Problematik, wenn Insektiziden vor Erreichen der Schadschwelle eingesetzt werden. Für den Schädling liegt diese bei 20 Prozent geschädigter Blattfläche am Ende des Schossens oder bei einem Ei bzw. einer Larve je Halm. „Das haben wir im Normalfall nicht und der Schaden wird oft stark überschätzt“, gibt Maier zu bedenken. Weil im Stadium 39 der Weizen ohnehin mit einem Fungizid behandelt werden muss, wird zur Sicherheit einfach noch ein Insektizid beigemischt. „Die Resistenzentwicklung folgt aber auf dem Fuß“, warnt Maier. „Denn jede Anwendung erhöht die Resistenz sowohl beim Schädling wie auch bei den anderen Insekten.“ Die breit wirksamen Pyrethroide räumen auch nützliche Insekten ab und schädigen die Blattlausfeinde, die nun ungehindert zufliegen können. Deshalb wird eine Blattlausbekämpfung erforderlich, „die ohne die vorherige Spritzung gegen das Getreidehähnchen gar nicht notwendig gewesen wäre, lautet Maiers Fazit.
Der stellvertretende Kreisvorsitzende des Bauernverbandes und CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig wünschte sich, die Kernaussagen des Referenten zur besten Sendezeit in den Medien. „Dann könnten die Landwirte wieder mehr Wertschätzung für ihren Beruf und ihre Produkte erreichen.“ Fakt sei eben, dass die Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland im internationalen und EU-Vergleich immer weniger werden. Umso wichtige sei eine bessere Kommunikation mit der Gesellschaft, damit diese Botschaft auch herüber komme.
Landrat Dr. Achim Brötel nahm seinen Auftritt in der Seckachtalhalle zum Anlass, sich bei den Landwirten für die Fehler zu entschuldigen, die im Kreis bei der Bearbeitung des Gemeinsamen Antrags 2018 aufgetreten sind. Ziel sei es, den restlichen von der Auszahlungssperre betroffenen Kontrollbetriebe bis April das Geld zur Verfügung zu stellen. Um eine Wiederholung auszuschließen und das Vertrauen in die Arbeit der Behörde wieder herzustellen, seien umfangreiche Nachschulungen durchgeführt worden.
Nach festgestellten Mängeln bei der Flächenerfassung waren nach den Worten von Dr. Ulrich Roßwag, Abteilungsleiter im Regierungspräsidium Karlsruhe, ausschließlich die 120 Kontrollbetriebe von der Auszahlungssperre betroffen. Dies Betriebe mussten alle neu überprüft werden. Dagegen seien 90 Prozent aller Direktzahlungen an die 960 Antragsteller im Kreis fristgerecht von Weihnachten ausbezahlt worden. Nach aktuellem Stand sind inzwischen 60 Vor-Ort-Kontrollbetriebe abgearbeitet und ausbezahlt worden.
Den Erhalt des Schefflenzer Schlachthofs und die Abwehr der Maut für die Landwirtschaft wertete Vorsitzender Gramling als Erfolge der Bauernverbandsarbeit. Nach dem von Geschäftsführer Andreas Sigmund vorgetragenen Geschäfts- und Kassenbericht entlastete die Bauernversammlung den Vorstand bei einer Stimmenthaltung.
In der abschließenden Diskussion wurde deutlich gemacht, dass es in der öffentlichen Auseinandersetzung eigentlich gar nicht um das Glyphosat geht. Vielmehr gehe es um die politische Macht und die moderne Landwirtschaft. Im Hintergrund stehen der Widerstand gegen zu große Anbauflächen und die Bevorzugung einer „kleinbäuerlichen Museumslandwirtschaft“. All dies werde jedoch durch die Politik selbst mit ihren eigenen Vorgaben zur Düngeverordnung und zum Pflanzenschutzrecht zunichte gemacht.




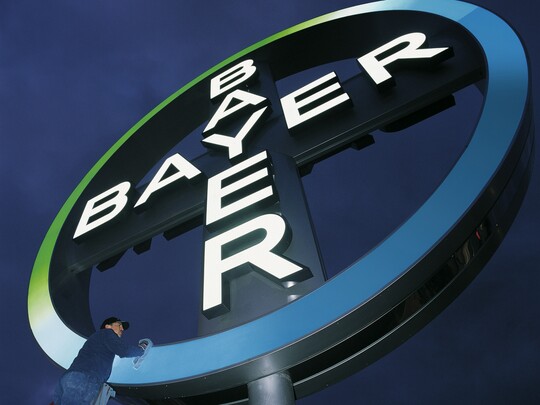

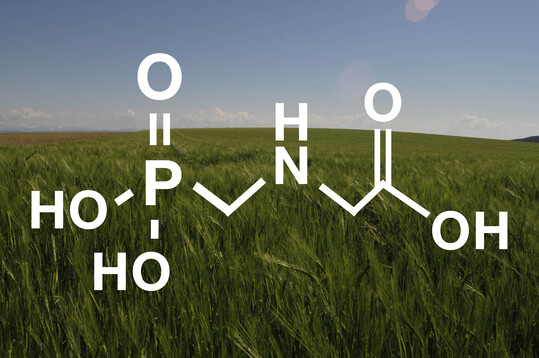
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.