Wenn der Roboter die Kühe satt macht
Nachdem sich das automatische Melken als Standardverfahren etabliert hat, steht nun die Fütterung im Mittelpunkt weiterer Automatisierungsschritte. Welche Hausaufgaben sollte der Betrieb im Vorfeld erledigen? Was sollte beim Standort und der gesamtbetrieblichen Situation vor der Umsetzung geklärt werden? Bevor in ein automatisches Futtervorlagesystem investiert, müssen zahlreiche Frage geklärt werden.
- Veröffentlicht am

In der Praxis findet man neben den häufiger anzutreffenden mobilen und schienengeführten Misch- und Verteilwagen zunehmend auch mobile, selbstfahrende Einheiten. Die Frage der Futtervorratslagerung in eigens dafür konzipierten Futterbunkern mit entsprechender Dosiertechnik oder als Silageblock auf betoniertem Untergrund mit Entnahme und Dosierung mittels Greifer ist eine individuelle Entscheidung.
Aber: es muss nicht unbedingt „automatisch“ sein – auch gut organisierte konventionelle Futtervorlagesysteme sind leistungsstark.Technik muss zur Herde passenIm betrieblichen Arbeitszeitbudget macht das tägliche Füttern mit knapp 20 bis 25 Prozent nach dem Melken den nächsten großen Zeitanteil im Arbeitsverfahren „Milchproduktion“ aus.
Große Unterschiede bei der Arbeitszeit
In der Praxis zeigten sich große Unterschiede in der Futtervorlagezeit, also der Zeit vom Beginn des Beladens des Mischwagens bis zur fertig vorgelegten Ration, je nach Mischsystem, innerbetrieblicher Organisation und Bestandsgröße. In einer Praxiserhebung in Hessen wurde knapp eine halbe Stunde pro Milchviehherde und Tag, je Kuh und Jahr etwa 2,6 Stunden aufgewendet, mit einer enormen Spanne von gemessenen 1,2 bis 5,0 Stunden.
Auch bei der Fütterung in Leistungsgruppen, die aus ernährungsphysiologischer Sicht wünschenswert ist, muss die Organisation passen, damit die Futtervorlagezeit in einem Zeitfenster von etwa drei Stunden pro Kuh und Jahr bleibt. Dies kann betriebsspezifisch zum Beispiel mit einer „Basismischung“ für den Gesamtbestand, bei der die Hochleistungsgruppe dann mit Kraftfutter gezielt aufgewertet wird, umgesetzt werden. Dies gilt auch für die Kraftfutterbeladung des Mischwagens, die gut organisierte Betriebe in zwei bis drei Minuten mit einer Kraftfuttervormischung statt vieler Einzelkomponenten erledigen.
Technik muss zur Größe des Kuhbestandes passen
Sobald das Kraftfutter an mehreren Lagerorten liegt, mit Handarbeit große Mengen bewegt werden müssen, die Anzahl der Einzelkomponenten steigt, Flüssigkomponenten zudosiert werden oder einfach nur der Schneckendurchmesser am Kraftfuttersilo zu klein ist, betragen die Beladungszeiten schnell 15 bis 20 Minuten pro Mischung. Gut strukturierte Arbeitsabläufe (kurze Wege, wenig Handarbeit, Kraftfuttervormischung) und eine an die Bestandsgröße angepasste Technik sind deshalb umso mehr Voraussetzung für zeitliche und ökonomische Einsparpotenziale.
Lesen Sie den gesamten Beitrag über verschiedene, automatische Futtervorlagesysteme in der aktuellen Ausgabe 50/2019 von BWagrar.


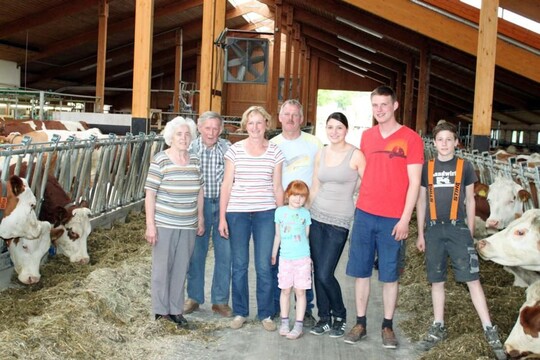







Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.