So werden die Kuhrationen nachhaltig
Auf Abruf füttern mit mehreren Futtersorten, zusätzliche Selektionstore einplanen, Kuhgruppen neu zusammenstellen und den Stall vorausschauend planen – alles Maßnahmen, um die Futterverwertung von Milchkühen zu optimieren. Aus gutem Grund: Denn der Aufwand an Nährstoffen kann durch eine an die Laktation angepasste Fütterung gesenkt werden. Hierfür sind allerdings neue Ideen und Konzepte gefragt.
- Veröffentlicht am

Die neuen rechtlichen Vorgaben der Düngeverordnung bleiben nicht ohne Folgen. Vielmehr sorgen sie dafür, dass tierhaltende Betriebe ihr Nährstoffmanagement anpassen müssen. Der Grund: Die eingesetzten Nährstoffe sollen möglichst effizient in Milch umgesetzt werden, um die Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz der Betriebe zu verbessern. Das betrifft vor allem den Stickstoff (N) im Futtereiweiß und die Phosphorgaben. Wenn die Nährstoffversorgung über dem Bedarf liegt, sinkt automatisch die Verwertung.
Inzwischen ist klar, dass eine Überversorgung zu keinen höheren Leistungen bei den Kühen führt. Durch eine an die Laktationsphase angepasste Futterration kann im Gegenzug Eiweiß und Phosphor eingespart werden Hierzu müssen die Kühe, abhängig vom Laktationsstadium („Phasenfütterung“), effizient versorgt werden (Merkblatt 444, DLG, 2020). Das geht nur mit neuen Futterkonzepten und, abhängig von der Betriebsstruktur, erheblichen Umstrukturierungen.
Verschiedene Verfahren
Die Umsetzung der Phasenfütterung für laktierende Kühe hängt von der Anzahl der vorgesehenen Phasen, der Anordnung des Melkstandes beziehungsweise des automatischen Melksystems (AMS), der Art der Konzentratfutterergänzung und der Herdengröße ab. In Tabelle 3 werden die Möglichkeiten der Phasenfütterung aufgeführt und die Vor- und Nachteile der vier Varianten gezeigt. In Variante 1 mit einer Trogration für alle laktierenden Kühe wird beispielsweise über die Kraftfutterstation oder mit Kraftfutter im Melkroboter die Nährstoffversorgung dem Bedarf angepasst. Variante 2 geht von Leistungsgruppen in verschiedenen Stallbereichen mit separaten Futtertischbereichen aus. Die Kühe werden nach dem Melken durch Selektionstore in ihre Bereiche geleitet.
Variante 3 ist für größere Herden geeignet. Hier wird die Herde nach Abkalbesaison aufgeteilt oder es findet Blockabkalbung in Teilherden statt. Die Mischrationen werden für die Teilherden (Frischmelker, Laktierende, Altmelker) konzipiert und dem Laktationsstand der Teilherde angepasst. Die Variante 4 wäre aus „Herdensicht“ unter dem Aspekt Tierwohl die beste Variante. Die Herde befindet sich bis auf die Abkalbephase immer in einem Herdenverband. Für die Tiere ließe sich Umgruppierungsstress vermeiden. Dieses Konzept erfordert entweder ein intelligentes Fressgitter, das den Zugang zu einzelnen Bereichen mit unterschiedlichen Rationen steuert oder separate Futtertischbereiche, deren Zugang für die jeweiligen Fütterungsgruppen über Tore mit Tieridentifikation im Stallbereich gesteuert werden kann.
Für die erste Version wäre ein Fressplatz für zwei Kühe vorzusehen. In Versuchseinrichtungen wurden mit diesem Konzept gute Erfahrungen gemacht (Gerster et al., 2017). Ob sich dieses Konzept in der Praxis umsetzen lässt, hängt stark von den Kosten ab, die aktuell bei etwa 4000 Euro je Fressplatz liegen. Die zweite Version ist kostengünstiger, erfordert aber ein dafür geeignetes Funktionsprogramm des Stalles. Bei der Umsetzung der verschiedenen Konzepte sollte man deshalb in jedem Fall berücksichtigen, ob im Melkstand oder mit einem AMS gemolken wird.
Phasenfütterung mit drei Phasen für laktierende Kühe im Melkstandbetrieb: Für alle Kühe wird eine Trogration angeboten (Variante 1). Die Phasenfütterung erfolgt über die Abrufstation. Dort werden mehrere Kraftfutter angeboten. Das Risiko subklinischer Azidosen wird hier am höchsten eingestuft, weil das Grobfutter-/Kraftfutterverhältnis schwanken kann (Tab. 2).
Die Realisierung der Phasenfütterung über Variante 2 mit räumlich getrennten Leistungsgruppen erfolgt über 3 abgestufte TMR-Mischungen. Die Herdenteilung in 3 Leistungsgruppen ist schwierig und in Herden unter 100 Kühen nicht umsetzbar. Alternativ werden zwei TMR-Mischungen passend für Phase 2 und 3 verfüttert. In Phase 1 wird die Nährstoffdichte der TMR der Phase 2 mit Kraftfutter über Abrufstation erhöht. Hier hat die Anordnung des Melkstandes für die Umsetzbarkeit zentrale Bedeutung (Abbildung 1).
In Variante 3 ist die Fütterung sehr variabel gestaltbar. Dort ist zu klären, wie die einzelnen Gruppen zum Melkstand und wieder zurück in die entsprechende Futtergruppe gelangen. Die Anforderungen an das Funktionsprogramm des Stalles sind vergleichbar mit denen der Variante 2.
Phasenfütterung mit 3 Phasen für laktierende Kühe im AMS-Betrieb: Im Betrieb mit einem AMS kann davon ausgegangen werden, dass mindestens 60 Kühe mit einem Roboter gemolken werden können. Grundsätzlich kann der Ansatz des Melkstandbetriebs übernommen werden.
Es wird eine Trogration für alle Kühe angeboten (Variante 1). Die Anpassung der Rationen an die Leistungsphasen erfolgt über die Abrufstation und die Kraftfuttergabe im AMS. Es werden mehrere Kraftfutter angeboten. Das Risiko subklinischer Azidosen wird auch hier am höchsten eingestuft, weil das Grobfutter/Kraftfutterverhältnis sehr schwanken kann (Tab. 1).
Variante 2 kann umgesetzt werden, wenn ein oder zwei AMS mittig angeordnet werden. Über ein zweites Kraftfutter im AMS kann eine dritte Phase realisiert werden. (Abb.3)
Variante 3 kann in Betrieben mit 60er-Kuh-Gruppen mit saisonaler Abkalbung oder Blockabkalbung umgesetzt werden.
Lesen Sie den gesamten Beitrag in der aktuellen BWagrar-Ausgabe 9/2022




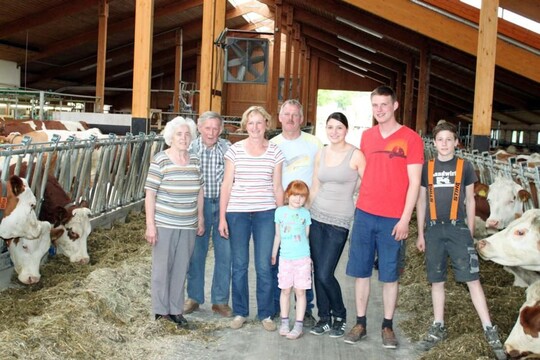




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.