So wird der Kuhstall digital
Ob es die Kontrolle der Herde, die Beobachtung der Kühe oder anstehende Entscheidungen sind: Die Daten aus der Milchviehhaltung zu vernetzen, Sensoren für die Überwachung der Kühe einzusetzen und die Datenmengen für die Vorhersage von Milchleistungen und Krankheiten zu nutzen, birgt Vorteile, wie der Rinderfachtierarzt Dr. Joachim Lübbo Kleen den gut fünfzig Zuhörern des BWagrar- Online-Seminars „Kuh Connected“ am Donnerstagabend (1. Oktober 2020) nahebrachte.
- Veröffentlicht am

Noch nutzen viele Landwirte Papier und Bleistift, tragen die Daten der Trächtigkeitsuntersuchung auf einem Formblatt ein oder lassen sich die aktuellen MLP-Ergebnisse per Post schicken“, berichtet Dr. Joachim Lübbo Kleen von seinen Eindrücken, die er als Rinderfachtierarzt und Berater von Betriebsbesuchen mitnimmt. Doch eine wachsende Zahl von Milchviehhaltern, das erläutert er den Zuhörerinnen und Zuhörern des Online-Seminars, nutzt inzwischen auch die elektronischen Möglichkeiten, die beispielsweise das Online-Kuhplanerprogramm RDV4M des Landeskontrollverbandes (LKV) oder das Programm Net Rind der Vereinigten Informationssysteme Tierhaltung (vit) bietet. Die Systeme stellen Aktions- und Tierlisten, Herdendaten, Fruchtbarkeitskennzahlen und Auswertungen der MLP bereit - auf dem PC oder als App auf dem Smartphone. Damit sollen, so erläutert es der Berater, der Bestand gemanagt und die Kuhdaten analysiert werden.
Vernetzte Systeme
In einem nächsten Schritt können die MLP-Daten hierfür als adis-Datei heruntergeladen werden, um sie danach in ein Herdenmanagement zu übernehmen. Hierfür gibt es inzwischen zahlreiche Programme, wie beispielsweise das deutsche System „Herdeplus“, „Uniform agri“ aus den Niederlanden oder das amerikanische Programm „Dairy Comp 305“. Diese frei im Handel verfügbaren Herdenmanagementsysteme sind anders als die von Melktechnikherstellern angebotenen Programme an keine bestimmte Hardware gebunden. Das biete Vorteile, wie Dr. Lübbo Kleen auf die Frage von Moderatorin Silvia Ruess antwortet, wie es um die Anwenderfreundlichkeit der Systeme stehe. Unabhängig davon, könnten freie und herstellergebundene Programme allesamt LKV-Daten auslesen und Daten zurückspielen. Entscheidend sei, dass die die Online-Anwendungen über Schnittstellen verbunden sind und miteinander kommunizieren könnten. Bei unterschiedlich konfigurierten Programmen läuft der anvisierte Datenaustausch ansonsten ins Leere.
Das gilt auch für die sich mittlerweile rasant entwickelnde Sensortechnik. Ob es Systeme für Bewegung und Aktivität, Brunsterkennung, die Ermittlung des Pansen-pH oder die optische Detektion von Bewegung und Körperkondition über eine Stallkamera sind: Die Auswahl an Systemen scheint schier grenzenlos. Doch um die Daten für die Steuerung der Herde nutzen zu können, müssen Sensoren und Herdenmanagementprogramme über eine Schnittstelle verbunden sein. Vernetzung heißt das Zauberwort, mit dem der Computerexperte denn auch den Weg in die Zukunft digitaler Ställe beschreibt.
Künstliche Intelligenz im Aufwind
Was mit der Messung von Bewegung, Wiederkäuen und dem pH-Wert der Kühe begann, mit der Interpretation der Daten seinen Fortgang fand, werde in naher Zukunft dazu führen, dass die erfassten Informationen Voraussagen zulassen und Milchviehhaltern Entscheidungshilfen an die Hand geben. Beispielsweise, um aus den ermittelten Fruchtbarkeitsdaten der Kühe Vorschläge für eine optimale Brunstnutzung und planbare Zwischenkalbezeiten abzuleiten. „Das senkt die Arbeitsbelastung und reduziert den Einsatz von Hormongaben“, beschreibt Kleen die Vorzüge solcher „Meta-Herdenmanagementsysteme“, die mit den Mitteln der Künstlichen Intelligenz (KI) große Datenmengen erfassen, interpretieren und Vorhersagen ermöglichen.
Solch ein Algorithmus könne dann errechnen, wieviel Milch die erfassten Kühe geben, wie hoch ihr Ketoserisiko sein und wieviel Milch der Betrieb liefern wird - vergleichbar, mit einem Autopilot, der nachdem er den Status quo ermittelt hat, denselben für die Zukunft voraussagt, um daraus die optimale Strategie für den Betrieb zu berechnen. Mit dem Ergebnis, dass die eingesetzten Sensoren das Tierwohl fördern und das „Beste für die Kühe“ auf den Weg bringen, wie Kleen große Hoffnungen in die Hightech-Anwendungen setzt.



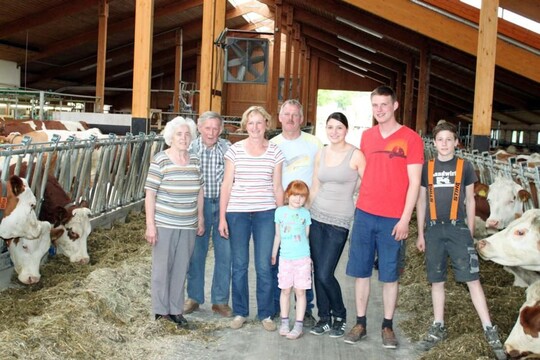




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.