Die Vorteile von Sensorsystemen im Milchviehstall nutzen
Sensorsysteme versorgen Milchviehhalter mit einer Vielzahl an Daten. Richtig genutzt kann sich die Investition schnell rechnen. Um das zu erproben, läuft am Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW) in Aulendorf seit Ende 2020 ein großes Projekt. Dabei werden die Daten von der Futterproduktion über die Rinderhaltung bis hin zur Molkerei durchgängig vernetzt. Der digitale Modellbetrieb (DigiMo) nutzt hierfür zahlreiche marktfähige Sensortechniken.
- Veröffentlicht am

Die Milchviehhaltung ist in den einzelnen Betrieben durch wachsende Tierbestände und arbeitswirtschaftliche Herausforderungen gekennzeichnet. Gleichzeitig entscheidet das produktionstechnische Können über den wirtschaftlichen Erfolg. Hinzu kommen komplexe Entscheidungen, die oft durch gesetzliche Bestimmungen und gesellschaftliche Erwartungen geprägt sind – gepaart mit steigenden Anforderungen für die Dokumentation. Deshalb sollen neue digitale Techniken, die Automatisierung und Sensorsysteme Unterstützung leisten.
Vom Ohrsensor zum Pansenbolus
In dem umfangreichen Projekt „DigiMo“ werden digitale Lösungen und Sensoren im Bereich des Futterbaus (Erträge, Qualität mittels NIRS, Tracking Tools) eingesetzt, die aber nicht Bestandteil des vorliegenden Beitrags sind. Ebenso bleiben Ansätze zur Automatisierung (Melken, Füttern, Entmisten, Stallklima) außen vor. In der Aulendorfer Rinderhaltung werden jedoch verschiedene Sensorsysteme am Halsband (Aktivität), am Ohr (Aktivität, Wiederkauen, Ortung) und im Pansen (Aktivität, Wiederkauen, pH-Wert, Körpertemperatur) eingesetzt. Gleichzeitig erfasst der Melkroboter (bei einem Teil der Herde) neben Daten zur Milchmenge auch automatisch die Zellzahlen sowie bei nicht trächtigen Kühen den Gehalt an Progesteron in der Milch. Die notwendige Vernetzung der Daten erfolgt in einem (von der Melktechnik unabhängigen) Herdenmanagementprogramm.
Vielzahl an Daten erfassbar
Auf dem Markt sind viele Sensorsysteme für unterschiedliche Zwecke verfügbar, wobei häufig Brunsterkennungssysteme auf der Basis von Beschleunigungssensoren zum Einsatz kommen (siehe dazu auch das DLG-Merkblatt 466). Bei der Auswahl durch den Praktiker spielen neben der Platzierung am Tier auch die Lebensdauer der Batterie (austauschbar?) sowie die Reichweite der Antenne (Einsatz in verschiedenen Ställen und/oder Weide) eine Rolle. Die Rohdaten aus den Sensoren müssen über Algorithmen zu Information und im Idealfall gleich zu Handlungsempfehlungen aufbereitet werden.
Je mehr Daten(-quellen) zur Verhaltensänderung beziehungsweise -überwachung einbezogen werden, desto gezielter lassen sich Hinweise ableiten. Stoffwechsel- und Gesundheitsprobleme werden neben der reinen Bewegungsaktivität (Laufen, Liegen, Stehen) auch über Parameter wie Änderungen in der Frequenz der Futter- und Wasseraufnahme, der Wiederkauaktivität sowie Informationen direkt aus dem Vormagen (pH-Wert, Körpertemperatur) detektiert.
Je genauer diese Parameter erfasst und kombiniert werden, desto früher können Probleme wie Hypercalcämie (Milchfieber), Ketose, Acidose oder Labmagenverlagerungen, aber auch Lahmheiten erkannt werden. Diese Hinweise auf subklinische Stoffwechselstörungen, oft bis zu zwei Tage früher als ohne Sensoren, stellen einen klaren Mehrwert von Sensorsystemen dar. Eine frühe Diagnostik reduziert schwere Krankheitsverläufe und trägt dazu bei, dass Leistungsabfälle vermieden und weniger Medikamente (Antibiotika) und Tierarztbesuche notwendig werden. Das trägt zum Tierwohl bei und vermindert den Arbeitsaufwand bei der Behandlung und Pflege (schwer-)kranker Tiere.
Masterarbeiten werten Systeme aus
Um die Effekte sowie praktischen Erkenntnisse verschiedener Sensorsysteme beurteilen und vergleichen zu können, wurden im Jahr 2023 am LAZBW Aulendorf drei Masterarbeiten bei Milchkühen erstellt:
Wiederkauen: Anna Krahmer verglich die Wiederkauaktivität (Minuten je Kuh und Tag) zweier Sensortechniken (Ohr-, Pansensensor) mit dem Nasenbandsensor (“RumiWatch“), der in wissenschaftlichen Versuchen meistens als Vergleichsmaßstab eingesetzt wird. Der Versuch umfasste drei Perioden von je zehn Tagen (Maximum beim Nasenband) an jeweils 14 Milchkühen (Fleckvieh). Gegenüber dem Nasenbandsensor wiesen sowohl der Ohrsensor (“Smartbow“) als auch der Pansenbolus (“SmaXtec“) pro Tag mehr Wiederkauminuten nach (siehe Abb. 1). Wichtiger als die absoluten Minuten pro Tier und Tag sind Phasen, in denen das Wiederkauen vom Normalverhalten abweicht. Diese Veränderungen und daraus folgende Alarmmeldungen wurden von allen Systemen gleichermaßen erkannt. Demnach sind beide Sensoren für die Praxis geeignet.
Brunsterkennung: Lisa Aumann untersuchte über vier Monate hinweg 48 Milchkühe mit drei Sensorsystemen zur Brunsterkennung (Ohr, Halsband, Pansen). Die Daten wurden mit dem Gehalt an Progesteron der Milch verglichen, der im Melkroboter erfasst wurde. Die Auswertung erfolgte mit einer Wahrheitsmatrix. Davon sind in Abbildung 2 einige Parameter dargestellt. Bezüglich der Sensitivität (wird eine Brunst erkannt) lag der Pansenbolus (SmaXtec) über den beiden anderen Sensoren am Ohr (Smartbow) beziehungsweise am Halsband (DeLaval). Auch im positiven Vorhersagewert (richtig erkannte an der Anzahl aller positiven Brunsten) schnitt der Pansenbolus am besten ab. Anzufügen ist, dass bei einer längeren Messperiode beziehungsweise mehr Tieren die Ergebnisse möglicherweise anders hätten ausfallen können. Zudem wurden die Werkseinstellungen der Systeme nicht verändert, die jeweils an den Betrieb beziehungsweise Tierbestand hinsichtlich der Schwellenwerte (Alarme) angepasst werden können.
Wird ein niedriger Schwellenwert eingestellt (also der Alarm früh ausgelöst), dann ist jede Brunst erfasst, aber es gibt auch mehr Fehlalarme durch Aktivitäten ohne Brunstereignis, die den Wert für die Sensitivität senken. Die Fehlerrate ist der Umkehrwert (zu 100 Prozent (%)) zum positiven Vorhersagewert.
Pansenboli: Leonie Kessler befasste sich mit den Hinweisen und Handlungsempfehlungen der Pansenboli (SmaXtec). Dort ergaben sich in vier Monaten bei 76 Tieren Zusammenhänge zwischen Aktivität, Wiederkauen, Pansen-pH-Wert und Körpertemperatur. Aus Abbildung 3 ist zu erkennen, dass jeweils gut 20 % der Alarme über den Temperatur- beziehungsweise pH-Sensor sowie 30 % über die Aktivität erfolgten. Beim LAZBW sind vor allem sehr frühe Alarme hinsichtlich Körpertemperatur (vermindert beziehungsweise erhöht) ein geschätztes Frühwarnsystem. Pansenboli werden derzeit von fünf Anbietern vertrieben, bei denen sich vor allem die Lebensdauer der Batterie (ohne pH-Sensor längere Einsatzdauer) unterscheiden. Bei ausschließlicher Erfassung von Aktivität (Brunst, Wiederkauen) sowie Körpertemperatur sollten aus unserer Sicht Pansenboli mindestens drei bis vier Jahre (durchschnittliche Anzahl der Laktationen pro Kuh) abdecken können.
Lesen Sie den gesamten Beitrag in der BWagrar-Ausgabe 16/2024.



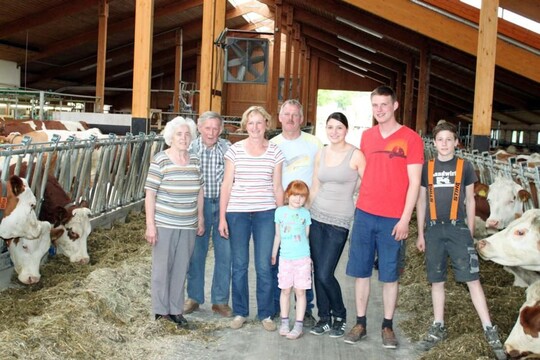




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.