Strengere Höchstwerte für Mykotoxine
- Veröffentlicht am

Für unverarbeitetes Getreide und Körnermais werden die Höchstwerte für Deoxynivalenol (DON) ab dem 1. Juli 2024 um 250 μg/kg gesenkt. Lediglich bei Hafer bleiben die DON-Höchstwerte mit 1.750 μg/kg konstant. Die Höchstwerte bei Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste wurden auf 1.000 μg/kg und bei Durum und Mais auf 1.500 μg/kg gesenkt. Zusätzlich treten ab dem 1. Juli 2024 erstmals gesetzliche Höchstwerte für die Fusariumtoxine T-2 und HT-2 in Kraft. T-2 und HT-2 werden hauptsächlich von Fusarienpilzen der Arten Fusarium langsethiae und Fusarium sporotrichioides produziert. Bisher gab es für T-2 und HT-2-Toxine lediglich Orientierungswerte. Damit wird die Vermeidung einer Fusariuminfektion im Getreideanbau noch entscheidender. Wichtig sind alle Maßnahmen, die eine Infektion vorbeugen und reduzieren, von der Sortenwahl über die Bodenbearbeitung, die Fruchtfolge, die Düngung, den Pflanzenschutz bis zum Erntezeitpunkt.
Durum und Weizen sind anfällig
Insbesondere Durum und Weizen werden häufig bei Niederschlägen in der Blüte von Fusarienpilzen befallen und können, sofern die Höchstgehalte bei Fusarientoxinen überschritten werden, nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Dinkel, Roggen und Gerste sind weniger anfällig, können aber auch befallen werden. Sollte die unbeständige Witterung während der Blüte anhalten, muss mit einem hohen Fusarien-Risiko gerechnet werden. Dann sollte eine Fusariumbehandlung eingeplant werden.
Frühe Weizensorten wie Obivan, RGT Volupto, Complice, Rubisko und Winner haben in warmen Lagen in der Oberrheinebene bereits Anfang Mai mit dem Ährenschieben begonnen. In kühleren Lagen sowie bei späteren Sorten wird die Ähre in Kürze erscheinen. Die Infektion geht meist von Fusariumsporen aus, die von Ernterückständen mit dem Wind auf die Ähre gelangen und dort bei Temperaturen von über 16 °C und einer Blattnässe von etwa 24 Stunden die Ährchen infizieren. Von den Ährchen kann der Pilz in die Ährenspindel wandern und weitere Ährchen infizieren. Außerdem kann es zu Kontaktinfektionen vom Fahnenblatt auf die Ähre bzw. von befallenen Ähren auf Nachbarähren kommen.
Eine Fusariuminfektion wird nach etwa drei Wochen durch ein Aufhellen und rötliche Verfärbung der befallenen Ährchen sichtbar. Dringt der Pilz bis in die Spindel vor, wird die Nährstoffzufuhr des darüberliegenden Teils der Ähre unterbrochen, was zum typischen Ausbleichen des oberen Ährenteiles (partielle Weißährigkeit) und zur Bildung von Schmachtkörnern führt.
Infektionswetter beobachten und rechtzeitig behandeln
Hält die unbeständige Witterung an, sollte eine Behandlung mit einem gegen Fusarium zugelassenen Fungizid in der Getreideblüte erfolgen. Dies gilt besonders bei anfälligen Sorten, in Maisfruchtfolgen und bei reduzierter Bodenbearbeitung. Entscheidend für den Erfolg ist eine infektionsnahe Behandlung im Zeitraum von zwei Tagen vor bis vier Tage nach einem Niederschlag während der Getreideblüte. Da die Blüte meist nicht gleichzeitig auf dem gesamten Schlag einsetzt, hat es sich bewährt, eine Fusariumbehandlung dann durchzuführen, wenn kurz nach dem Ährenschieben Niederschläge fallen und Temperaturen von über 16 °C gemessen werden.
Der ideale Zeitpunkt für eine Fusariumbehandlung in Durum und Weizen ist, wenn bei den Haupttrieben die Staubbeutel in der Mitte der Ähren zu beobachten sind. Für einen ausreichenden Wirkungserfolg sollte die empfohlene Fungizidaufwandmenge eingehalten werden.
Fusarium-Fungizide haben eine Nebenwirkung gegen Mutterkorn
Aus Laborversuchen ist bekannt, dass Triazole wie Metconazol (z.B. Plexeo, Caramba), Prothioconazol (z.B. Bolt, Proline, Curbatur) und Tebuconazol (z.B. Folicur) nicht nur eine gute Wirkung gegen Fusariumpilze haben, sondern auch das Wachstum des Mutterkornpilzes weitgehend stoppen. Bei einer Fusariumbehandlung mit diesen Wirkstoffen in der Blüte ist daher auch eine Nebenwirkung gegen Mutterkornbefall zu erwarten. Mutterkorn befällt zwar in erster Linie Fremdbefruchter wie Roggen, kann aber bei der aktuell feucht-kühlen Witterung und damit einer langen Getreideblüte auch Selbstbefruchter wie Weizen infizieren. Für unverarbeiteten Weizen gilt nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 für Mutterkorn-Sklerotien ein Höchstgehalt von 0,2 g/kg.
Neue gesetzliche Höchstgehalte für die Fusarietoxine DON, T-2 und HT-2 in unverarbeitetem Getreide ab dem 1. Juli 2024
| Erzeugnis | DON (μg/kg) bis 30 Juni 2024 | DON (μg/kg) ab 1. Juli 2024 | Summe T-2 und T-2 (μg/kg) ab 1. Juli 2024 |
|---|---|---|---|
| Unverarbeiteter Weizen, Dinkel und Roggen | 1.250 | 1.000 | 50 |
| Unverarbeiteter Durum und Mais | 1.750 | 1.250 | 100 |
| Unverarbeitete Gerste (außer Braugerste) | 1.250 | 1.000 | 150 |
| Unverarbeiteter Hafer incl. Spelzen | 1.750 | 1.750 | 1.250 |
| Unverarbeitete Braugerste | 1.250 | 1.000 | 200 |




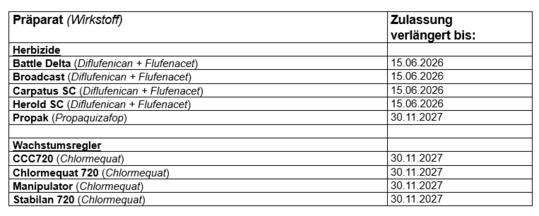
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.