Sicher ist sicher
Was sich auf Schweinebetrieben inzwischen etabliert hat, hält nun auch in Rinderherden verstärkt Einzug. Krankheitserregern und Giftstoffen soll schon im Vorfeld mit gezielten Hygienemaßnahmen der Garaus gemacht werden – bevor die Gesundheit von Rindern und Kühen gefährdet und Keime in und außerhalb der Herden verschleppt werden. Mit Dr. Hans-Jürgen Seeger vom Rindergesundheitsdienst Aulendorf (Landkreis Ravensburg) haben wir uns über die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen für Kühe und Rinder unterhalten.
- Veröffentlicht am

BWagrar: Herr Dr. Seeger, welche Fehler begegnen Ihnen auf den Rinderbetrieben am häufigsten, wenn es um die Biosicherheit in den Beständen geht?
Seeger: Der häufigste Fehler ist das oft zu geringe Bewusstsein der Rinderhalter für Biosicherheit. Häufig machen sich die Betriebsleiter viel zu wenig Gedanken darüber welche Erreger zum Beispiel durch Tiere aus anderen Beständen eingeschleppt werden können. Viele Betriebe haben sich in der Vergangenheit ansteckende Krankheiten wie Mortellaro, Paratuberkulose, Flechten aber auch euterkranke Kühe zugekauft. Auch indirekte Erregerverschleppungen im Zusammenhang mit Personen- und Fahrzeugverkehr kommen nicht selten vor.
Bei bestandseigenen Problemen wie beim Kälberdurchfall oder bei Euterentzündungen werden oft die Hygienemaßnahmen im Bestand nur unzureichend umgesetzt. Dabei können durch Hygienemaßnahmen in vielen Fällen Neuinfektionen verhindert und Behandlungen dadurch deutlich reduziert werden. Das macht sich dann natürlich auch wirtschaftlich positiv bemerkbar.
BWagrar: Welche Versäumnisse können für die Gesundheit der Tiere die schwerwiegendsten Folgen haben?
Seeger: Am gravierendsten sind die Folgen natürlich bei der Einschleppung von bekämpfungspflichtigen Tierseuchenerregern. In den letzten Jahren hatten wir beispielsweise mehrere BHV1-Ausbrüche, die durch indirekte Erregerverschleppungen übertragen wurden und die für die betroffenen Betriebe fatale Folgen hatten. Gerade in der Endphase der Sanierung einer Tierseuche, ist eine erhöhte Wachsamkeit und Konsequenz notwendig um diese Seuche auch wirklich komplett zu tilgen.
Vor hochansteckenden Seuchen wie der Maul- und Klauenseuche (MKS) sind wir schon seit Jahrzehnten verschont geblieben. Welche katastrophalen Folgen die Einschleppung von MKS-Erregern haben kann, hat der MKS-Ausbruch 2001 in England und den Niederlanden gezeigt.
BWagrar: Wie hat sich in den vergangenen Jahren das Bewusstsein für die Gefahr der Erregerverschleppung verändert?
Seeger: Durchaus. Viele Betriebe haben sich in den letzten Jahren spezialisiert und sind gewachsen, Dies führt natürlich zu einem höheren Schadensrisiko in diesen Betrieben. Damit kommt der Biosicherheit zwangsläufig mehr Bedeutung zu. Leider wird das nicht von allen wachsenden Betrieben im gleichen Maße realisiert.
Außerdem haben die BHV1-Ausbrüche der letzten Jahre die Rinderhalter in den betroffenen Regionen besonders sensibilisiert und ein hohes Bewusstsein für die Gefahren der Erregerverschleppung geschaffen.
BWagrar: Welche Maßnahmen sollten Rinderhalter auf jeden Fall umsetzen
Seeger: In jedem rinderhaltenden Betrieb, auch in Kleinstbetrieben, sollte ein sauberer Platz mit Waschbecken, Seife, Handtuch und einer Desinfektionsmöglichkeit vorhanden sein. In jedem mittleren und größeren rinderhaltenden Betrieb - vor allem natürlich in Milchviehbetrieben in denen betriebsfremde Personen mehr oder weniger regelmäßig in den Bestand kommen - sollten betriebseigene Stiefel und Schutzkleidung und ein geeigneter Platz zum Umziehen zur Verfügung stehen.
Außerdem sollte beim Einstallen von Tieren aus anderen Beständen auf den Gesundheitsstatus geachtet werden. So sollten Tiere aus Mastbeständen nicht in Milchviehbestände eingestallt werden. Durch eine Quarantäne und Einstallungsuntersuchung im aufnehmenden Bestand kann zwar das Verschleppungsrisiko minimiert, aber nicht völlig ausgeschlossen werden.
BWagrar: Welche Maßnahmen können nach und nach auf den Höfen installiert werden, um die Biosicherheit zu erhöhen?
Seeger: Umfangreichere Maßnahmen wie die Errichtung von Hygieneschleusen, die Schaffung und Befestigung von Zufahrtswegen oder die Trennung bestimmter Altersgruppen sind häufig nur im Zusammenhang mit Umbau- oder Neubaulösungen zu erreichen. Vor allem bei Neubauten sollte die Biosicherheit planerisch mitbedacht und baulich konsequent umgesetzt werden.



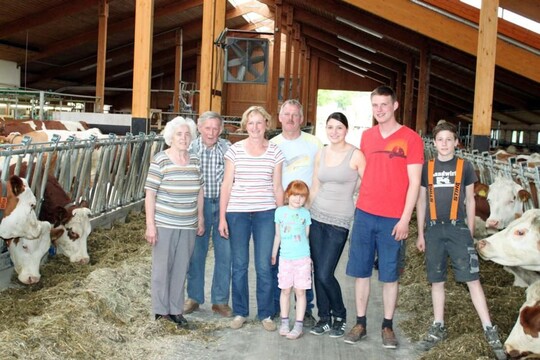









Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.