Geruch und Geschmack müssen stimmen
Wenn die Silage einen unangenehm stechenden, dumpfen oder gar klebstoffartigen Geruch aufweist, ist guter Rat teuer. Die Kühe reagieren in der Regel mit Futterverweigerung; sinkende Milchleistung oder gar fütterungsbedingte Krankheiten können die Folge sein.
- Veröffentlicht am

Erstaunlicherweise berichten Landwirte, bei denen solche Fehlgärungen auftreten, in der Regel davon, dass die betroffenen Silagen gut vergoren und hoch verdichtet wären beziehungsweise dieses Phänomen in Silagen minderer Qualität seltener auftritt.
Auf diese Weise fehlvergorene Silagen „auslüften“ zu lassen, um die flüchtigen Geruchsveränderungen durch Ausgasen zu entfernen, oder über eine Pufferung der Ration mit einem entsprechend wirksamen Mineralfutter den Geschmack und damit die Futteraufnahme wieder zu stabilisieren, ist für die Gesundheit der Tiere mit einem hohen Risiko behaftet. Diese Notbehelfe können das Problem der mangelhaften Fütterungseignung betroffener Silagen nicht vollständig lösen.
Hefen sind schuld
Bekanntermaßen ist die Zahl der Faktoren, die den Silierprozess beeinflussen können, schon sehr groß, und da diese sich teilweise auch noch gegenseitig beeinflussen, steigt die Zahl der Möglichkeiten für Fehler beim Silieren quasi ins Unendliche an. Im Falle der Gerüche nach Klebstoff oder Nagellackentferner sind die Ursache sogenannte flüchtige organische Komponenten (volatile organic compounds, VOC). Chemisch sind diese VOCs den Estern zuzuordnen, diese sind dann flüchtig, wenn ihre Kohlenwasserstoffseitenketten (Bild 1, „R“) relativ kurz- oder verzweigtkettig sind.
Auf der Säureseite spielen Milch- oder Essigsäure, die in der Silage in großen Mengen vorhanden sind, eine besondere Rolle, während auf der alkoholischen Seite neben Ethanol auch diverse andere Alkohole infrage kommen können. Neueren Untersuchungen zufolge spielt unter den entstehenden Estern Ethyllactat, d. h. der Ester aus Ethanol und Milchsäure, eine besonders wichtige Rolle.
Der bei der Silierung ablaufende Hauptprozess ist eine Milchsäurevergärung, d. h. Milchsäure ist in der Silage gewollt und für eine verlustarme Silierung auch essenziell wichtig, weswegen sehr viele biologische Siliermittel eben gerade Milchsäurebakterien enthalten. Ethanol hingegen wird bei der alkoholischen Vergärung hauptsächlich von Hefen produziert. Es gilt deshalb, über eine Hemmung des Hefewachstums im Silierprozess die erzeugte Menge an Ethanol in der Silage zu verringern.
Siliermittel gefragt
Das Einbringen von Hefen in das Silo selbst lässt sich nicht verhindern, diese sind im Futter stets vorhanden. Jedoch kann man ihre Vermehrung über die Einlagerungsbedingungen und das Silagemanagement beeinflussen. Es ist weithin bekannt, dass Hefen nach Verbrauch des Restsauerstoffs, sprich beim Erreichen anaerober Verhältnisse, ihren Stoffwechsel auf alkoholische Gärung umschalten und bei der Energiegewinnung letztlich Ethanol erzeugen.
Interessanter ist jedoch die Zeit, in der den Hefen noch Restsauerstoff zur Verfügung steht. Hier veratmen sie vorhandene Zucker zu Kohlendioxid und Wasser, und auch nur unter Sauerstoffzufuhr können sie sich effektiv vermehren. Im Klartext bedeutet dies: Eine Hefevermehrung kann schon beim Einbringen des Futters durch zügiges Einlagern und ausreichendes und vor allem sorgfältiges Verdichten auch der Rand- und oberen Schichten und sofortiges luftdichtes Verschließen des Silierguts verringert werden. Dies ist auch der Zeitpunkt, wo man Hefe hemmende Substanzen oder Milch- beziehungsweise Essigsäure produzierende Bakterien, das heißt Siliermittel, zum Futter hinzugeben kann. Die schnelle Milchsäuregärung durch Zugabe von Milchsäurebakterien-Präparaten hilft, den Gehalt an Hefen in der Silage zu beschränken.
In einer der letzten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Hefen haben Forscher der Humboldt-Universität zu Berlin festgestellt, dass die Salze der Sorbinsäure (Sorbate), Benzoesäure (Benzoate) und Propionsäure (Propionate) bei diesem speziellen Einsatzzweck besonders vielversprechend sind. Natürlich sind unter den vielfältigen DLG-geprüften und mit DLG-Gütezeichen ausgezeichneten Siliermitteln auch solche chemischen Konservierungsstoffe bzw. entsprechende Kombipräparate zu finden. Während der Lagerung und Entnahme sollte man durch sorgfältiges Abdecken, einen ausreichenden Vorschub und den Verzicht auf auflockernde Entnahmegeräte, wie zum Beispiel eine Frontladerschaufel, einen Lufteinfluss möglichst verhindern.
Auch wenn sich atypische Gerüche durch flüchtige organische Kohlenwasserstoffverbindungen (VOCs) noch nicht mit letzter Sicherheit verhindern lassen, kann man ihrer Entstehung doch effektiv entgegenwirken, indem man das Wachstum und die Vermehrung von Hefen im Futterstock so gut als möglich kontrolliert. Siliermittel mit DLG-Gütezeichen, die auch auf Sorbaten, Benzoaten oder Propionaten als wirkaktiven Inhaltsstoffen beruhen, können hier eine sehr große Hilfe sein. Deren Wirksamkeit wurde in einer umfassenden Verleihungsprüfung für das Prüfzeichen festgestellt, und ihre gleichmäßige Qualität wird durch regelmäßige Kontrollen der DLG in Werk, Handel und beim Landwirt kontinuierlich überprüft.

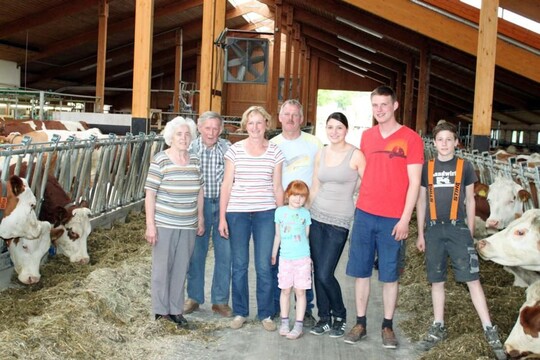








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.