Mit Grundfutter-Check bares Geld sparen
Milchkühe kommen auch mit weniger Kraftfutter aus, als ihnen normalerweise gefüttert wird. Die Kühe werden davon nicht mehr krank oder geben weniger Milch. Zu diesem Ergebnis kommt ein Fütterungsversuch am Landwirt-schaftlichen Zentrum (LAZBW) in Aulendorf im Rahmen des Verbundprojektes „optiKuh“. Die bundesweite Fütterungsstudie startete vor drei Jahren, nun ist sie offiziell abgeschlossen. Letzte Auswertungen stehen allerdings noch aus.
- Veröffentlicht am

Weniger Kraftfutter für die Kühe zukaufen zu müssen, senkt die Kosten in der Milcherzeugung. Schlussendlich spielt der Einsatz von weniger Kraftfutter in den Rationen für die Düngebilanz eine wichtige Rolle. „Spätestens, wenn die Betriebe eine Stoffstrombilanz vorlegen müssen, werden Milchviehhalter den Nährstoffeinsatz in den Futterrationen überdenken“, vermutet Tierernährungsexperte Dr. Thomas Jilg vom Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW) im Gespräch mit BWagrar.
Kühe passen sich an
Was passiert mit Kühen, wenn sie weniger Kraftfutter vorgelegt bekommen? Geben die Wiederkäuer weniger Milch, wenn sie anstatt der gewohnten 250 Gramm nur noch 150 Gramm Kraftfutter, hochgerechnet auf den Liter Milch, bekommen? Und: Wie wirkt sich der eingeschränkte Kraftfuttereinsatz auf die Gesundheit der Wiederkäuer aus? Fragen, für die sich Elisabeth Gerster, die über das optiKuh-Verbundprojekt promoviert und Referatsleiter Jilg zu Beginn des bundesweiten Versuches im Dezember 2014 interessierten und die sie für Fleckvieh mit ihren Kollgen an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Grub und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf im Themenblock „Fütterungsintensität“ klären wollten.
Genügend Energie aus dem Grobfutter
Mit Erfolg, wie Gerster und Jilg, nun kurz vor dem offiziellen Ende des Projektes, aus den Versuchsergebnissen schlussfolgern. Die Fleckviehkühe am LAZBW kamen mit weniger Kraftfutter in den Rationen zurecht, ohne, dass sie in den Milchleistungen spürbar einbrachen und Gefahr liefen, dass ihr Stoffwechsel in die Knie ging und sie an Ketose erkrankten. Auch in Grub und Triesdorf kamen die Fleckviehkühe mit der reduzierten Kraftfuttermenge zurecht. Vorausgesetzt, das machen die beiden Versuchsinitiatoren deutlich, die Kühe werden mit genügend Energie – mindestens 6,6 MJ NEL– aus dem Grobfutter versorgt.
Zusätzlich zu den Mindestenergiehalten muss die Qualität von Silagen, Heu und Stroh passen. „Der Landwirt sollte ein Ass sein in der Grundfutterbereitung. Ansonsten kann er den Kraftfutteranteil in der Ration nicht ohne Weiteres senken“, ergänzt LAZBW-Direktor Franz Schweizer, der die zweijährige Studie auf dem Atzenberg begleitete und solchen Verbundprojekten Zukunft bescheinigt. Dadurch, so der Leiter der oberschwäbischen Forschungsanstalt, könnten staatliche Mittel effizienter eingesetzt werden als dies bei Einzelstudien der Fall ist. Die Versuche werden aussagekräftiger, weil mehr Daten erhoben werden können.
„Mit Milchleistungen von 6300 kg aus dem Grobfutter pro Kuh und Jahr haben wir dennoch nicht gerechnet“, sagen Gerster und Jilg und sind noch immer überrascht von Anpassungsvermögen der Wiederkäuer. Die Kühe in der Versuchsgruppe mit weniger Kraftfutter erzeugten annähernd 75 Prozent ihrer Milchleistung aus dem Grobfutter. Mit einer Einschränkung: Was sie weniger an Kraftfutter aufgenommen haben, haben sie über das Grobfutter aufgenommen. Der Grund: Irgendwoher muss die Energie für die Hochleistungskühe kommen. „Die Tiere reagierten flexibel auf das Futterangebot“, stellten die Wissenschaftler fest. Ein Vorzug, den vor allem Fleckviehkühe auf sich verbuchen können. Das bestätigten auch die Versuche in Grub und Triesdorf.
Grobfutterqualität entscheidend
Die Kraftfutter-Frage spielt allerdings nicht nur beim Tierwohl und der Milchleistung eine Rolle. Denn mit dem Kraftfutter gelangen Stickstoff (N) und Phosphor (P) auf die Betriebe, die später als Gülle auf Wiesen und Äckern landet. Mit der neuen Düngeverordnung, die für größere Milchviehbetriebe ab diesem Jahr zusätzlich eine Stoffstrombilanz vorsieht, könnte es für manchen Milchviehhalter eng werden werden, was die Grenzwerte für Nährstoffe anbelangt, die auf den Feldern ankommen dürfen.
Umso wichtiger werde deshalb die Frage, wie viel Kraftfutter Milchviehhalter in das System eintragen. Abgesehen davon verfetten vor allem altmelkende Kühe, wenn sie zuviel Kraftfutter fressen, wie Jilg ergänzt: „Das ist ökonomisch nicht sinnvoll.“ Auch wenn man das Kraftfutter selbst erzeugt. Vielmehr gehe es darum, sein Grünlandmanagement unter die Lupe zu nehmen und zu optimieren: Durch den Schnittzeitpunkt, die Schnitthöhe des Grases und zeitnahe Einlagerung und Verdichtung des Siliergutes. Wie es um die Qualität der Silagen bestellt ist, darüber gibt dann eine Futteruntersuchung Aufschluss. Allein das Augenmaß reiche nicht, um Gras- und Maissilagen verlässlich zu beurteilen. Rund 50 Euro kostet solch ein Futtercheck. Geld, das gut investiert sei, versichern Gerster und Jilg. Genauso wie die regelmäßige Überprüfung des Mineralstoffgehaltes in den Silagen. Mit dem Ergebnis in der Tasche, lässt sich beispielsweise Phosphor im Mineralfutter häufig einsparen. Die Kosten sinken ein weiteres Mal.
Optimiert Milch erzeugen
Das nächste Forschungsprojekt steht derweil schon an. „emissionCow“ lautet der englisch Titel der anvisierten Folgeuntersuchung, was mit Kuh-Emissionen übersetzt werden kann. „Dabei geht es um Selektion auf Effizienz. Wir wollen erfassen, wie viel Milch Kühe pro eingesetztem Kilogramm Futter erzeugen können“, erläutert Jilg. Hierfür setzt das Aulendorfer Forscherteam die Sammlung von Daten zur Futteraufnahme von Fleckviehkühen für die bundesweite Datenbank, die mit dem ersten Verbundprojekt optiKuh gestartet war, fort. Andere Einrichtungen werden folgen. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren.
Projekt optiKuh: Effizient füttern rechnet sich
Das bundesweite Forschungsprojekt optiKuh startete im November 2014 und läuft bis Ende März 2018. 15 Kooperationspartner aus Forschungs-, Milchkontrolleinrichtungen und der Wirtschaft waren bei dem Verbundprojekt mit von der Partie. Sie trugen Wissen über Zucht, Haltung, Pflege und Futter zusammen. Geklärt werden sollte die Frage, ob durch Zucht, gezielte Fütterung und moderne Sensortechnik eine effiziente und nachhaltige Leistung der Milchkühe möglich ist, die zudem Tierwohl-Ansprüche erfüllt. Die Forscher wollten herausfinden, wie eine Ration für unterschiedliche Intensitäten am besten zusammen gesetzt wird. Ein Teil des Projekts war schließlich dem Vorhaben gewidmet, den genetischen Fingerabdruck der Kühe zu bestimmen, um zu erfahren, ob es genetische Merkmale gibt, die dazu führen, dass eine Kuh Futter besonders gut verwerten und in Milch umsetzen kann. Hier liegen die Ergebnisse noch nicht vor. An den zwölf beteiligten Versuchseinrichtungen wurden exakte Fütterungsdaten erhoben. Das LAZBW war eine von sechs Einrichtungen, die den optiKuh-Fütterungsversuch durchführten. Das BMEL förderte das Verbundprojekt mit 2,55 Millionen Euro, davon gingen 231.000 Euro an die Forschungsanstalt in Aulendorf.

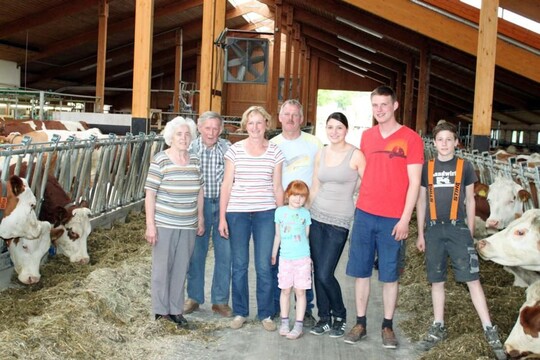








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.