Wohin steuert die Agrarpolitik nach 2020?
Im Juni 2018 hat die EU-Kommission die Vorschläge zur GAP nach 2020 vorgestellt. Bis heute sind knapp 7000 Änderungsanträge dazu eingegangen. Viele Fragen sind offen und müssen diskutiert werden. Auf der Fachtagung des Landesbauernverbands (LBV) am vergangenen Freitag in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) fragte man sich deshalb: Wohin steuert die Agrarpolitik?
- Veröffentlicht am

Die GAP nach 2020 gleicht derzeit noch einer Großbaustelle: Mit dem Vorschlag wurde einerseits Staub aufgewirbelt und andererseits eine erste Leitplanke gesetzt. Eines war den rund 150 Besuchern der Veranstaltung, zu der zum einen der Landesbauernverband in Baden-Württemberg(LBV) als auch die lokalen Bauernverbände Main-Tauber-Kreis und Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems eingeladen haben, schnell klar: Die GAP gleicht derzeit eher noch einer Schotterpiste als einer gut ausgebauten Autobahn. Wie die neun spezifischen Ziele der GAP künftig aussehen sollen ist klar, betont Dr. Martin Scheele, Generaldirektion Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission. Dazu zählen:
- die Stärkung der Landwirtschaft in der Wertschöpfungskette,
- Klimaaktionen,
- ein nachhaltiges Ressourcenmanagement,
- die Erhaltung von Landwirtschaft und Biodiversität,
- Perspektiven für den Generationswandel,
- die Förderung der Ländlichen Entwicklung,
- Verbesserung landwirtschaftlicher Einkommen,
- eine erhöhte Krisenfestigkeit als auch
- Nahrungsmittelsicherheit, Qualität und Tierwohl.
Doch ist das Umsetzungsmodell mit Vereinfachung, Ergebnisorientierung und Subsidiarität der richtige Weg, um diese Ziele zu erreichen, fragt sich der ein oder andere Landwirt. Die EU will den Rechtsrahmen festlegen und die Mitgliedsstaaten etablieren nationale GAP-Pläne. Die Umsetzung erfolgt dann nach Maßgabe des GAP-Strategie-Plans, der begleitet und durch jährliche Umsetzungsberichte dokumentiert wird. Am aktuellen System will die Brüsseler Behörde nicht festhalten, da es zu komplex sei. Laut Scheele konzentriert sich die derzeitige GAP zu sehr auf den Haushalt und die Verteilung der Mittel. Mit der Reform der GAP sollen künftig die politischen Ergebnisse in den Fokus rücken. Dazu sei es wichtig, dass entsprechende Kontrollmechanismen installiert werden, die den Umsetzungsfortschritt kontinuierlich überprüfen. „Mit diesem Mittel haben wir die Chance eine leistungsfähige und nachvollziehbare Gemeinsame Agrarpolitik zu installieren“, erklärt Scheele abschließend.
Nachbesserungen bei Verhandlungen
Für Alois Bauer vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) haben die Brüsseler Vorschläge Licht- und Schattenseiten. „Es ist noch nicht alles so, wie es das BMEL gerne hätte. Bei den bevorstehenden Verhandlungen müssen wir vor allem bei den Vereinfachungen nachbessern. Außerdem brauchen wir verbindliche Leitplanken auf EU-Ebene sowie mehr Flexibilität für Mitgliedstaaten“, gibt Bauer zu bedenken. Ein Sorgenkind ist der Mehrjährige Finanzrahmen, der noch nicht verabschiedet ist. Rund 365 Milliarden Euro sind von 2021 bis 2027 für die Gemeinsame Agrarpolitik verfügbar - fünf Prozent weniger wie bisher. Das Fördersystem mit der 2-Säulen-Struktur wird, wie von der Bundesregierung vorgeschlagen, beibehalten. Ein Erfolg, wie Bauer betont. Kürzungen wird es aber in beiden Säulen geben: In der ersten Säule (u.a. Direktzahlungen und Marktmaßnahmen) fallen diese mit 3,9 Prozent noch überschaubar aus. Die Mittel der zweiten Säule (ELER) werden um 15 Prozent reduziert. Mit den Geldern strebt das BMEL die Umsetzung folgender Ziele an:
- Höheres Umweltambitionsniveau: Beitrag zum Tier- und Klimaschutz
- Erhalt der Einkommenswirkung von Direktzahlungen
- Deutliche Vereinfachungen und Planungssicherheit für Landwirte
- 2-Säulen-Struktur
- Marktorientierung
Der Teufel steckt im Detail
Knackpunkte der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik verstecken sich in der „Grünen Architektur“. Bisher gab es Cross Compliance (CC), Greening sowie freiwillige Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht einen Ausbau vor. Neben der neuen, erweiterten Konditionalität (bisheriges CC + Greening + zusätzliche Standards) soll es für Mitgliedsstaaten ein obligatorisches „Eco-Scheme“ (1. Säule) als auch freiwillige Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (2. Säule) geben. Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV), mahn an, dass eine Ausweitung standardmäßiger Verpflichtungen Konditionalität) bei gleichzeitiger Kürzung des EU-Agrarbudgets nicht akzeptabel ist. Die Konditionalität solle auf das Wesentliche beschränkt werden und mehr Raum für freiwillige und einkommenswirksame Maßnahmen geschaffen werden.
Ein sehr sensibles Thema ist der Begriff „Echter Landwirt“, wie Hemmerling bestätigt. Dieser könnte sich auch für zahlreiche Nebenerwerbslandwirte in Baden-Württemberg negativ auswirken. Für sie kann es zu einem Förderausschluss kommen. Im Brüsseler Vorschlag zur GAP nach 2020 heißt es: „Der Begriff „echter Betriebsinhaber“ ist so zu definieren, dass gewährleistet ist, dass diejenigen, deren landwirtschaftliche Tätigkeiten nur einen unwesentlichen Teil ihrer gesamten wirtschaftlichen Tätigkeiten ausmachen oder deren Haupttätigkeit nicht in der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit besteht, keine Unterstützung erhalten, ohne dass Betriebsinhaber mit mehrfacher Tätigkeit von vornherein von der Unterstützung ausgeschlossen werden. Die Begriffsbestimmung ermöglicht es, anhand von Bedingungen wie Einkommensprüfungen, Arbeitskräfteaufwand im landwirtschaftlichen Betrieb, Unternehmenszweck und/oder Eintragung in Registern zu bestimmen, welche Betriebsinhaber nicht als echte Betriebsinhaber gelten.“ Wird der „Echte Landwirt“ zum Bestandteil der GAP so müssen sich alle Nebenerwerbslandwirte einer Wesentlichkeitsprüfung unterziehen.
Abschließend fasst Hemmerling all die Anliegen des Bauernverbandes treffend zusammen: Das Umsetzungsmodell ist der Kern der Reform ist und man muss darauf achten, dass die Maßnahmen nicht so wirken, dass sie den Markt verzerren. Er sieht nicht nur Abstimmungsprobleme zwischen der EU und Deutschland, sondern vor allem auch dann in der nationalen Umsetzung zwischen Bund und Ländern.
Die Zeit läuft davon
Norbert Lins, Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, macht sich vor allem Sorgen um die zeitliche Umsetzung des Pakets. „Es müssen jetzt Kompromisse geschaffen werden. Das kann bei den knapp 7000 Änderungsanträgen eine langwierige Sache sein“, ist sich der Politiker sicher. Ob es im Agrarausschuss im März bereits zu einer Abstimmung kommen kann, ist fraglich. Bis 2021 haben alle Beteiligten Zeit, eine Schlussabstimmung herbeizuführen. Gelingt das nicht, braucht es eine Übergangslösung. Und die Zeichen deuten darauf hin, denn es gibt neben dem fehlenden (nicht verabschiedeten) Mehrjährigen Finanzrahmen noch eine weitere, nicht kalkulierbare Unbekannte: Der ausstehende Brexit. Es bleibt also die Frage: Was passiert mit der Landwirtschaft nach 2020?


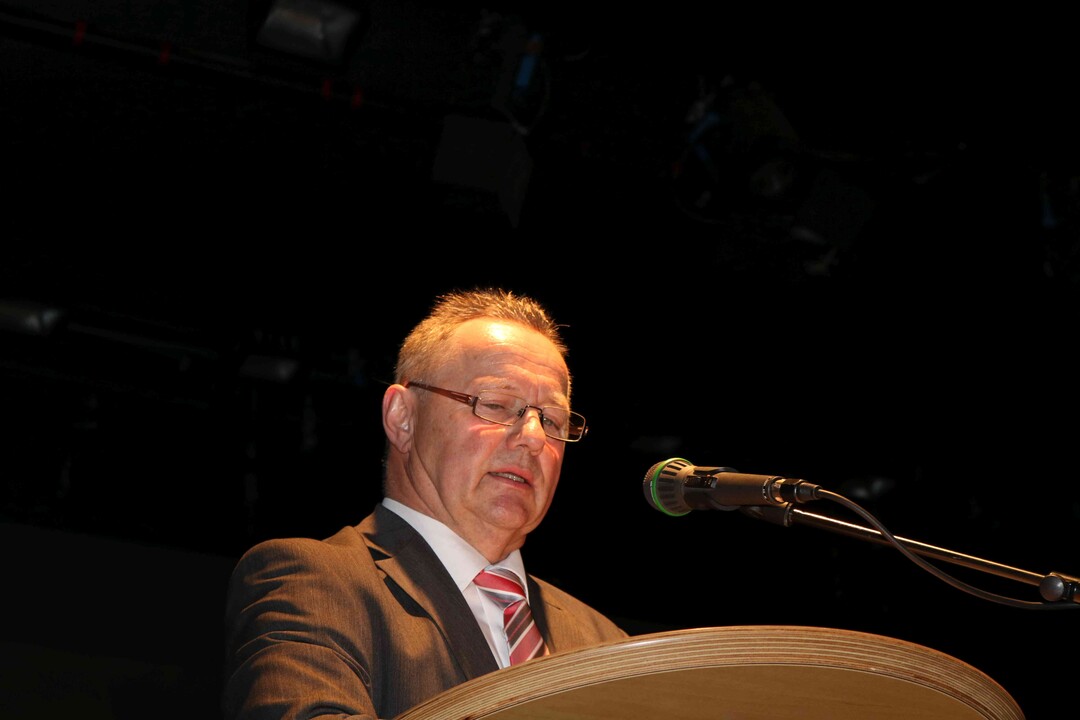











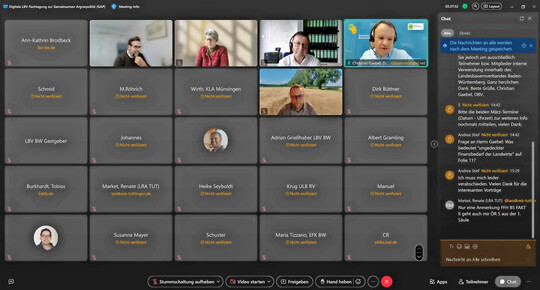
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.