Ministerium legt Folgenabschätzung vor
Der Umbau zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung bleibt Thema. Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung (sogenannte Borchert-Kommission) prüft derzeit, wie das in Deutschland möglich ist. Nach der Machbarkeitsstudie im März, bei der die Finanzierbarkeit auf rechtliche Umsetzung geprüft wurde, hat das Johann Heinrich von Thünen-Institut nun in einer Folgenabschätzung untersucht, wie sich der geplante Umbau auf die Branche, auf die Betriebe und die Verbraucher auswirkt.
- Veröffentlicht am

Die wissenschaftliche Folgenabschätzung bekräftigt das Vorgehen des Bundesministeriums beim Umbau der Tierhaltung – die wesentlichen Ergebnisse sind:
- Sofern die Politik den gesamten Nutztiersektor Deutschlands in einem überschaubaren Zeitraum auf ein deutlich höheres Tierwohlniveau bringen möchte, ist staatliches Eingreifen nötig. Der Vorschlag des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung, die gesellschaftlich erwünschte Transformation des Nutztiersektors mit einer Kombination aus Anreiz- und Gesetzesmaßnahmen vorzunehmen, ist ein wirtschaftlich schlüssiges Maßnahmenbündel.
- Wenn es keine Umsetzung einer solchen nationalen Nutztierstrategie gibt, werden sich die Landwirte aufgrund der anhaltenden Verunsicherung weiterhin mit Investitionen in die Tierhaltung und Tierwohl zurückhalten.
- Demgegenüber kann eine kraftvolle, von der Bevölkerungsmehrheit getragene weiterentwickelte Nutztierstrategie dazu führen, dass zahlreiche tierhaltende Betriebe zuversichtlicher in die Zukunft blicken.
- Die Strategie bietet ihnen eine klare Perspektive über den Zukunftskurs und einen verlässlichen wirtschaftlichen Ausgleich für die tierwohlbedingten Mehraufwendungen.
- Landwirte brauchen Verlässlichkeit beim Umbau: Es ist wichtig, dass der Staat mit jedem einzelnen investierenden Unternehmen einen Vertrag über die Förderung schließt. Die in der EU-Finanzplanung üblichen Perioden reichen hier nicht aus.
- Um nicht nur für die einzelnen Investitionen, sondern für den Nutztiersektor insgesamt eine Verlässlichkeit zu erzeugen, sollte bereits bei der Weiterentwicklung der Nutztierstrategie darauf geachtet werden, einen breiten Konsens (a) in der Parteienlandschaft und (b) zwischen Bund und Ländern herbeizuführen. Außerdem sollte die Umstellung der Praxisbetriebe durch umfassende Begleitforschungsmaßnahmen flankiert werden, damit eine möglichst große Transparenz über die Folgen (a) für das Tierwohl und (b) für die betriebliche Rentabilität hergestellt wird.
- Ohne Tierwohlkennzeichen wird eine Transformation nicht gelingen. Denn die Verbraucher müssen am Produkt erkennen können, wo mehr Tierwohl angewandt wurde.
Professor Dr. Folkhard Isermeyer führt aus, dass das Thünen-Institut zu einer positiven Bewertung des Umbaus der Nutztierhaltung kommt. Allerdings betont er nochmals: „Wenn gesellschaftlich gewollt ist, dass künftig alle Nutztiere in Deutschland auf ein deutlich höheres Tierwohlniveau kommen, dann lässt sich dieses Ziel nicht allein über den Markt erreichen. Unsere Folgenabschätzung zeigt: Der Staat sollte perspektivisch die Tierwohlauflagen erhöhen und die Landwirte durch verlässliche Tierwohlprämien in die Lage versetzen, die erhöhten Kosten zu tragen.“
Bis zum Jahr 2040 soll die Nutztierhaltung in Deutschland komplett auf die definierte Stufe 2 umgebaut sein. "Durch Sog und Druck für die Landwirte", wie Isermeyer sagt. Allerdings müssen Landwirte den Umbau auch stemmen können. So seien die errechneten zehn bis 20 Prozent Mehrkosten im europäischen Binnenmarkt ein k.o.-Kriterium im Wettbewerb, wenn hier nicht entsprechende Verkaufserlöse generiert werden. Eine Investitionsförderung sowie eine Tierwohlprämie seien ebenso wichtig. "Für die Gesellschaft wird es etwa drei bis vier Milliarden Euro pro Jahr kosten", so Professort Dr. Folkhard Isermeyer. Das seien rund 0,5 Cent pro Mahlzeit.
Jochen Borchert stellt nochmals klar: Wir brauchen die Zustimmung der Gesellschaft und der Landwirte. Die Akzeptanz der Gesellschaft hänge davon ab, dass sichtbar etwas passiere in den Ställen, für die Landwirte sei die verbindliche Zusage der Regierung, zur Finanzierbarkeit entscheidend.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erklärte: „Für den Umbau der Tierhaltung haben wir in dieser Legislatur ein massives Momentum erzeugt. Es gibt einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens für unseren Weg. Zudem ist allgemein akzeptiert, dass mehr Tierwohl mehr Geld kostet und, dass das nicht alleine die Angelegenheit der Tierhalter sein kann, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist".
Die Ideen zur Finanzierung liegen seit März vor. Dass der Vorschlag eines Tierwohl-Solis eine Mehrheit bekommt, hält Klöckner für unwahrscheinlich. Eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer oder eine Tierwohlabgabe sei hier wahrscheinlicher.







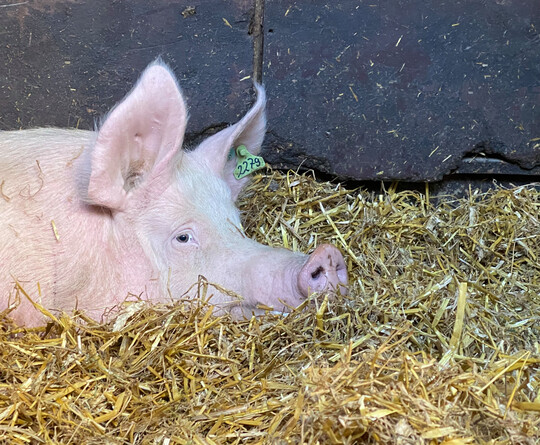
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.