25-jähriger Landwirt zu Gefängnisstrafe verurteilt
Das Urteil im Prozess am Landgericht Memmingen im Rahmen des Allgäuer Tierschutzskandals ist gefallen. Mit einer Gesamtstrafe von zwei Jahren auf Bewährung für den 68-jährigen Senior Johann Baptist H. und einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten für seinen 25-jährigen Sohn Florian H. fiel es beträchtlich aus.
- Veröffentlicht am

Das erste umfangreiche Verfahren im sogenannten Tierskandal vor der großen Strafkammer des Landgerichts Memmingen endete mit der Verurteilung der beiden angeklagten Landwirte. Der Vorsitzende Richter Christian Liebhart verkündete am Dienstag dieser Woche (29. November 2022) die Entscheidung der Kammer.
Der inzwischen 68 Jahre alte Johann Baptist H. wurde wegen quälerischer Misshandlung von Wirbeltieren durch Unterlassen in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Sein 25 Jahre alter Sohn Florian H. wurde aus demselben Grund, jedoch in zehn Fällen, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.
Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, so teilt das Landgericht Memmingen hierzu mit, können zur Bewährung ausgesetzt werden. Von dieser Möglichkeit habe die Kammer bei Johann H. Gebrauch gemacht. Als eine von mehreren Bewährungsauflagen muss er 12.000 Euro an einen Gnadenhof bezahlen. Gegen beide Angeklagte wurde zudem ein fünfjähriges Tierhalteverbot ausgesprochen.
Kranke Tiere sich selbst überlassen
Der Vorsitzende sprach in seiner etwa einstündigen Urteilsbegründung von „verheerenden Bedingungen vor Ort“. Auf den völlig überfüllten Hofstellen, auf denen die Anzahl der zur Verfügung stehenden Liegeplätze in keinerlei Relation zur Anzahl der dort gehaltenen Tiere standen, habe der Kot bis zu einem halben Meter hochgestanden. Trotz offensichtlicher Behandlungsbedürftigkeit der betroffenen Rinder und Kälber und wiederholter konkreter behördlicher Vorgaben zur Beseitigung der Missstände (Originalton des Richters: „Ignoranz gegenüber behördlichen Vorgaben“), hätten die Angeklagten Tierärzte entweder gar nicht oder zu spät hinzugezogen. Hierdurch erlitten die betroffenen Tiere länger andauernde erhebliche Schmerzen und mussten als Folge oftmals notgetötet werden.
Die unterschiedliche Strafhöhe resultiere, so die Kammer, in erster Linie aus der unterschiedlichen Anzahl von Fällen, für die die Angeklagten verurteilt wurden. Hierbei habe auch berücksichtigt werden müssen, dass ein Fall nicht einem betroffenen Tier entspricht, sondern regelmäßig jeweils mehrere Tiere betroffen gewesen seien.
Die Angeklagten hätten sich im Laufe der Verhandlung eingelassen und hätten ihr Verhalten mit Betriebsblindheit und Überforderung begründet und erklärt, dass ihnen die schlimmen Zustände erst aufgrund der angefertigten Fotos bewusst geworden seien und es ihnen leidtue.
Im Lauf der 17-tägigen Hauptverhandlung, in der zahlreiche Zeugen und Sachverständigen vernommen wurden, wurden mit der Zustimmung aller Beteiligten weitere Tatvorwürfe, die Gegenstand des Verfahrens waren, wie zum Beispiel das Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen, eingestellt. Dies geschah, da nach Überzeugung der Kammer die dafür zu erwartenden Strafen neben den Strafen für die verbleibenden Tatvorwürfe (die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz), nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würden.
Gegen das Urteil können die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten innerhalb einer Woche Revision einlegen. Der Bundesgerichtshof prüft dann das Verfahren auf Rechtsfehler. Das heißt die Beweisaufnahme wird nicht nochmals durchgeführt.

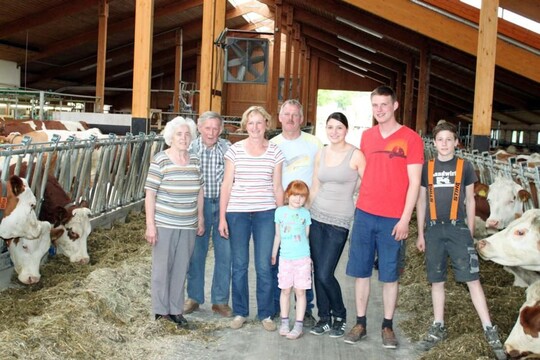









Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.