Das Augenmerk auf die Vermarktung legen
Im Hegau trafen sich die Mitglieder der Vereinigte Hagelversicherung VVaG (Vereinigte Hagel) am 4. Dezember zu ihrer zweitletzten von insgesamt acht Bezirksversammlungen im Land an der Autobahn-Raststätte im Hotel „Zur Engener Höhe“. In den Gastvorträgen von Martin Munz, Saaten-Union GmbH, und Stefanie Strebel, Ceresal GmbH Mannheim, ging es darum, Risiken zu minimieren – sowohl im Anbau als auch in der Vermarktung.
von Matthias Borlinghaus Quelle Matthias Borlinghaus erschienen am 09.12.2024„In diesem Jahr war sehr, sehr viel los. Wir hatten fast jede Woche neue Schäden“, berichtete Friedrich Ehrmann, Leiter der Bezirksdirektion Stuttgart der Vereinigte Hagel. Es begann im April mit Hagel in den Niederlanden, dann kam der Frost in Deutschland Ende April, bei dem neben Kern-, Stein- und Beerenobst vornehmlich die Reben geschädigt wurden. Erstmals habe der Spätfrost auch den Winterraps getroffen. „Unsere Sachverständigen, die selber zuhause auch noch einen Betrieb haben, waren sechs Wochen lang non-stop im Einsatz. Ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz“, so Ehrmann.
Wie Ehrmann berichtete, konnten die Mitglieder bei einem Festakt in Gießen „200 Jahre gelebte Gegenseitigkeit feiern“. Im Jahr 1824 nämlich wurde die damalige Leipziger Hagel gegründet, die sich als Vorläufer der VVaG erst 1993 mit der Norddeutschen Hagel zur heutigen Vereinigten Hagel zusammengeschlossen hat. Gewachsen ist die Vereinigte Hagel im Jahr 2024 in erster Linie im Ausland (siehe BWagrar Ausgabe 49, Seite 55). Insgesamt, so Ehrmann, habe man sich in den vergangenen Jahren vom Hagelversicherer zum Mehrgefahrenversicherer entwickelt. Er plädierte für einen raschen Aus- und Aufbau der Förderung einer Ernte-Mehrgefahren-Versicherung, am besten einheitlich für ganz Deutschland. Ziel seien keine Rundum-sorglos-Pakete, sondern weiterhin bezahlbare Versicherungslösungen.
Überdurchschnittlich nasses Jahr
Allein im Mai wurden in Süddeutschland 42.000 ha landwirtschaftliche Fläche geschädigt. Ende Mai hieß es Land unter, als Starkregen von besonderer Intensität mit 200 Liter pro Quadratmeter an einem Wochenende Felder überflutete und Flüsse über die Ufer treten ließ. Martin Munz von der Saaten-Union hob die großen Regenmengen im abgelaufenen Jahr hervor: „Meine Erfahrung ist, dass nasse Jahre viel schlimmer sind als trockene Jahre, zumindest für Baden-Württemberg.“ Beim Weizen habe man wegen der Nässe deutlich niedrigere Erträge eingefahren. Eine hohe Wassersättigung habe entsprechend auch den Krankheitsdruck für die Kulturen erhöht. Hilfreich seien eine solide Grunddüngung (insbesondere mit Kali), Auflockerung der Fruchtfolgen und eine gute Bodenstruktur mit Humusaufbau. Hierfür spiele der Anbau von Zwischenfrüchten eine wichtige Rolle. Zur weiteren Risikominimierung empfiehlt Munz gute Bedingungen bei der Aussaat und die richtige Sortenwahl: „Wenn es zu nass ist, lieber etwas später säen.“ Auch bei der Abreife lasse sich durch den Einsatz mehrerer Sorten mit unterschiedlichen Reifezeiten das Anbaurisiko so verteilen, dass zu unterschiedlichen Terminen geerntet wird.
Laut Munz dürfte der Dinkelmarkt im kommenden Jahr wieder attraktiver werden. „Da sind wir weit weg vom aktuellen Weizenpreis und auch die Produktionskosten sind günstiger als bei Weizen“, so Munz. Mindestens ebenso attraktiv erscheint ihm der Markt für Hafer. „Der Markt wächst gigantisch, was mit den Ernährungsgewohnheiten der jungen Generation zusammenhängt.“ Der Hafer bringe in der Regel höhere Erträge als die Sommergerste und komme fast ohne Pflanzenschutzmittel aus. Auch am Markt für Körnerleguminosen tue sich einiges. Der Weizen verliere seit Jahren an Proteingehalt (dieses Jahr im Schnitt nur 11,4 Prozent). Wer Weizen mit über 13 Prozent Eiweißgehalt abliefern kann, bekommt deutlich mehr ausbezahlt. Tipp: „Sie müssen künftig viel stärker auf gesunde und proteinstabile Sorten setzen, um die wenigen Pflanzenschutzmittel, die uns noch bleiben werden, überhaupt möglichst lange zu erhalten.“ Insgesamt dürfte es mehr auf die Vermarktung ankommen.
Vermarktung im Fokus
Das bestätigte Stefanie Strebel, Geschäftsführerin der Ceresal GmbH Mannheim, die vor ihrem Wirtschaftsingenieursstudium bei der BayWa als Rohstoffhändlerin tätig war, bevor sie sich mit der Firma KS agrar selbstständig gemacht hat. „In der Produktion sind wir beim Weizen mit 80 dt pro Hektar weltweit an der Spitze. In der Vermarktung haben wir noch ein riesiges Potenzial, uns weiter zu optimieren“, ist die Brokerin überzeugt. In den USA beispielsweise würden Landwirte, die ihre Preise nicht über die Warenterminbörse absichern, als Spekulanten eingestuft. „Das ist genau die umgekehrte Denke als hierzulande. Höchste Zeit, darüber nachdenken, ob wir die Terminbörsen nicht besser für unsere Anliegen nutzen sollten“, ermunterte Strebel. Wie das geht? Am besten über sogenannte Optionen, sagte Strebel. Hier bekommt man das Recht, aber nicht die Pflicht, eine Ware zu einem bestimmten Preis an der Warenterminbörse zu verkaufen. Nachteil beim klassischen Vertragsanbau sei, dass sich der Preis nicht für einen langen Zeitraum (3 Jahre) im Voraus absichern lässt. Das ginge nur über die Warenterminbörse, entweder über Futures oder über Optionen. Bei den Futures wird die Ware auf Termin verkauft.
Beispiel für eine Option: Man kauft sich im Dezember eine Option, mit der man im Mai 2025 den Weizen bei einem Preis von 230 Euro pro t verkaufen kann. Diese Option kostet 14 Euro pro t. Nun ist aber der Weizenpreis im Laufe der Monate (Dezember bis Mai) um 40 Euro auf 270 Euro pro t gestiegen. Damit liegt der Optionswert bei 40 Euro pro t. Entsprechend lässt sich ein Verkaufspreis von 256 Euro pro t erzielen (230 + 40 - 14 = 256). So hat man zu einem großen Teil am Preisanstieg partizipiert, ohne weitere Risiken. Sollte jedoch der Preis bis zum Mai von 230 Euro um 40 Euro auf 190 Euro fallen, bleibt man nur auf den Kosten für die Option sitzen. Weil die Option dann wertlos ist. Der Verkaufspreis läge dann bei 216 Euro pro t (230 - 14 = 216). Diesen Preis hat man sich also in jedem Fall gesichert, egal wie tief er am Markt tatsächlich fällt.
 © Matthias Borlinghaus„Ein Umparken im Kopf und unternehmerisches Denken sind gefragt.“ Stefanie Strebel, Geschäftsführerin Ceresal GmbH
© Matthias Borlinghaus„Ein Umparken im Kopf und unternehmerisches Denken sind gefragt.“ Stefanie Strebel, Geschäftsführerin Ceresal GmbH
Mithilfe dieser Strategie könne man bei ähnlichen Kosten wie bei einer Einlagerung von steigenden Preisen profitieren. Zudem lässt sich die eigene Liquidität unmittelbar verbessern und das Lagerrisiko entfällt. In ihrem Vortrag erläuterte Strebel, warum die Erzeugerpreise beim Weizen gerade so schwach ausfallen. Ihr Fazit: „Wir sehen bei Weizen wenig Abwärtspotenzial, aber wir sehen auch kein großes Aufwärtspotenzial. Die Seitwärtsbewegung der letzten Monate dürfte weiter anhalten.“ Ein Grund dafür sei der Mais. Auch dieser bewege sich bereits seit Mai dieses Jahres in einem „Seitwärtskanal“. Die weltweite Versorgung des Marktes sei gut und stetig. „Der Mais macht den Markt. Er ist ein wesentlich größerer Preistreiber als der Weizen“, sagt Strebel. In Südamerika stünden die Mais- und Sojabestände für die Ernte im Januar 2025 gut, es werden 5 bis 10 Prozent bessere Ernten als im Vorjahr erwartet. Probleme gebe es mit Aflatoxinen bei der ausländischen Ware, weshalb von der Ernährungsindustrie gute Prämien für inländischen Mais bezahlt würden.
Über Teilverkäufe nachdenken
Bei Raps lagen die Preise am 4. Dezember an der Terminbörse bei 527 Euro pro Tonne für den Februar und für den Mai-Termin bei 520 Euro pro Tonne. „Das sind stolze Preise“, so Strebel. Derzeit liegt das Prämienniveau bei plus 7 auf Mannheim. Entsprechend wird der Raps zu einem Großhandelspreis von 534 Euro pro Tonne gehandelt (527 + 7 = 534). Für die Erzeuger bedeute dies, dass sie beim Landhändler derzeit 505 bis 510 Euro pro Tonne erzielen könnten. „Unserer Meinung nach ist das ein wirklich interessanter Vermarktungspreis. Da sollte man sich überlegen, ob man nicht etwas verkaufen möchte“, so Strebel. Der Preisabstand zum Weizen liege bei einem Faktor von 2,4. Das sei hoch und gebe einen Hinweis darauf, dass der Raps derzeit vergleichsweise gut bezahlt wird. Während sich der Rapspreis in den vergangenen Monaten eher positiv entwickelt hat, standen die Preise für Soja als Leitölsaat unter Druck. Hier lag die weltweite Produktion deutlich über dem Verbrauch. Insgesamt aber nahmen die Pflanzenöle (Palmöl, Raps- und Sojaöl sowie Sonnenblumenöl) eine positive Entwicklung, nicht zuletzt, weil sie in Richtung Bio-Diesel und anderen technischen Verwertungen weiterverarbeitet werden.
Mit Raps lässt sich derzeit gut Geld verdienen
Die sogenannte Crush Margin (Handels- beziehungsweise Gewinnspanne für den Verarbeiter) von Raps für die Ölmühle bezeichnete Strebel aktuell als „sehr auskömmlich“, obwohl das Preisniveau für den Raps eher hoch ist. Das bedeute, dass an Raps und seinen Nebenprodukten gut verdient werde. Mit ein Grund für das stabile Preisniveau beim Raps sei die Streichung der Exportförderung Chinas von gebrauchten Speiseölen und eine Rekordverarbeitung von Sojabohnen in den USA.
Eigene Produktionskosten in Schach halten
Im Raum stehe derzeit die Frage, wie sich der globale Handel weiter entwickeln wird. Die Sorge vor Handelskriegen und Zöllen sei groß. Sollten sich die Abschottungstendenzen verschärfen, erhöhen sich inflationsgetrieben die Preise, das gelte ebenso für eine Leitzinssenkung, die den Rohstoffpreisen ebenfalls zu einem Preisauftrieb verhelfen würde. „Es war noch nie so schwer wie jetzt, die Märkte richtig abzuschätzen“, sagt Stefanie Strebel. Den Betriebsleitern riet sie, sich verstärkt auf sich selbst zu konzentrieren, weil man die äußeren Faktoren als einzelner nicht beeinflussen könne. Die Frage lautet: „Was ist für mich ein guter Preis?“ Dies sollte die Grundlage für jede Vermarktung sein. Um dies herauszufinden, lohne der Blick auf die Vollkostenrechnung.
Dankesworte
„Als Züchter müssen wir Sorten züchten, die den Stresslevel wieder nach vorne bringen“, meinte Karsten Gros von der Saaten-Union und versprach, die Teilnehmer bei der Sortenwahl zu unterstützen. Der Bezirksvorsitzende Klaus Grieshaber bedankte sich bei Ulrich Eppler, dem langjährigen Leiter der Bezirksdirektion Stuttgart, der dieses Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde: „Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten.“ Des Weiteren bedankte er sich bei allen Schätzern und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im Jahr 2024.

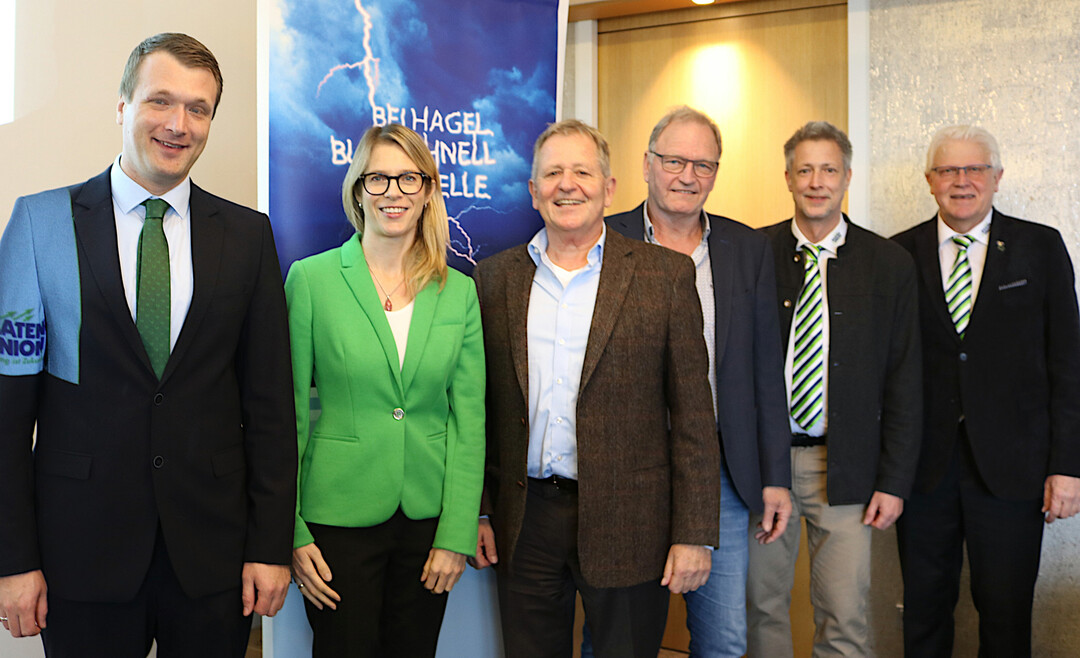




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.