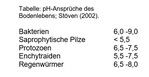
Praxisnahe Konzepte für den Klimaschutz
Wie kann die Landwirtschaft aktiv zum Klimaschutz beitragen? Diese Frage stand im Zentrum des Projekts „Landschaft als CO2-Speicher“, das gemeinsam mit Betrieben aus dem Südschwarzwald und der Oberen Donau praxisnahe Maßnahmen zur Kohlenstoffbindung im Boden untersuchte. Die Ergebnisse zeigen: Viele klimafreundliche Ansätze lassen sich erfolgreich in den Betriebsalltag integrieren – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen. Mit dem Projekt wurde ein wichtiger Schritt hin zu einer klimaresilienten Landwirtschaft gemacht.
von Paula Glenz, Unique Landuse erschienen am 11.06.2025Die Landwirtschaft hat das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten – vor allem durch die Speicherung von CO2 im Boden. Im Rahmen des Projekts „Landschaft als CO2-Speicher“ haben Landwirtinnen und Landwirte aus dem Südschwarzwald und der Oberen Donau dabei geholfen, praxistaugliche Maßnahmen zur Kohlenstoffbindung zu erarbeiten und zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen: Viele Klimaschutzmaßnahmen lassen sich gut in den Betriebsalltag integrieren, einige benötigen jedoch noch gezielte Unterstützung.
Das Projekt, das von den Naturparken Südschwarzwald und Obere Donau gemeinsam mit der unique land use GmbH durchgeführt wurde, verfolgte ein klares Ziel: Maßnahmen zur CO2-Bindung in der Landwirtschaft zu identifizieren und deren Potenzial gemeinsam mit den beteiligten Modellbetrieben realistisch zu bewerten.
Auch der Betrieb Braun-Keller war Teil des Projekts. Für ihn stand außer Frage, sich zu beteiligen: „Der Klimawandel betrifft uns alle – aber gerade uns Landwirte trifft er besonders. Deshalb war es mir wichtig, hier mitzuwirken“, erklärt der Betriebsleiter.
Für jeden Hof erarbeiteten das Projektteam individuelle Empfehlungen, die im Rahmen von Vor-Ort-Besuchen mit den Landwirtinnen und Landwirten besprochen wurden. Die Vorschläge reichten von bekannten Maßnahmen wie dem Anbau von Zwischenfrüchten, reduzierter Bodenbearbeitung oder der Integration von Agroforstsystemen bis hin zu neueren Ansätzen wie der Albrecht-Bodenuntersuchung oder der Grasnarbenbelüftung.
Potenziale und Hürden in der Praxis aufdecken
Ein bedeutendes Kriterium bei der Auswahl der empfohlenen Maßnahmen war ihr Mehrfachnutzen. Die vorgeschlagenen Verfahren sollten nicht nur zur CO2-Speicherung beitragen, sondern zugleich den Betrieb und die Umwelt in vielfacher Hinsicht stärken – etwa durch verbesserten Erosionsschutz, eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenperioden und die Förderung der biologischen Vielfalt.
Eine wichtige Erkenntnis des Projekts war, welche Klimaschutzmaßnahmen in den Betrieben bereits erfolgreich umgesetzt werden, wo noch Hürden bestehen und welche Ansätze in der Region das größte Potenzial bieten – sowohl im Hinblick auf die verfügbaren Flächen als auch auf die betrieblichen Rahmenbedingungen und die Bereitschaft zur Umsetzung.
So zeigte sich beispielsweise, dass der Anbau von Zwischenfrüchten auf vielen Betrieben bereits fest in die Fruchtfolge integriert ist. Andere Maßnahmen, wie etwa das holistische Weidemanagement, spielen bislang kaum eine Rolle – meist aufgrund fehlender Infrastruktur, begrenzter Flächen oder des hohen personellen Aufwands.
Boden im Fokus: Gesundheit zahlt sich aus
Besonders großes Interesse zeigten die teilnehmenden Betriebe am Thema Bodengesundheit. Empfehlungen wie die Durchführung erweiterter Bodenanalysen, der gezielte Ausgleich von Nährstoffverhältnissen sowie die Förderung des Bodenmikrobioms stießen auf breite Zustimmung.
Auch die „reduktive Kompostierung“ fand Anklang: Viehhaltende Betriebe verfügen in der Regel über die benötigten Ausgangsstoffe wie Mist, Gülle oder Gärreste sowie kohlenstoffhaltige Materialien wie Holzhackschnitzel, Grünschnitt oder Stroh. Durch den gezielten Aufbau von Humus verbessert sich nicht nur die Bodenstruktur und Wasserspeicherfähigkeit, sondern auch die langfristige Produktivität der Flächen.
Auf Basis der flächenscharfen Planung konnten die Projektpartner berechnen, welches CO2-Einsparpotenzial in der Region steckt. Würden die vorgeschlagenen Maßnahmen auf allen geeigneten Flächen in den Naturparken Südschwarzwald und Obere Donau umgesetzt, ließen sich anfänglich pro Jahr bis zu 185.000 Tonnen zusätzliches CO2 binden. Das entspricht den jährlichen Emissionen von rund 23.000 Menschen. Pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche und Jahr käme so etwa eine Tonne CO2 zusammen — ungefähr so viel, wie in einer Buche mit 30 cm Durchmesser gespeichert ist.
Einheitliche Standards für Zertifikate
Damit dieses Potenzial auch genutzt werden kann, braucht es jedoch verlässliche Rahmenbedingungen. Unsicherheiten wie Förderkürzungen oder gesetzliche Änderungen hemmen vielerorts die Bereitschaft, in langfristige Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Besonders bei mehrjährigen Projekten wie Agroforstsystemen sind außerdem die Eigentums- oder Pachtverhältnisse von zentraler Bedeutung.
Zum Abschluss des Projekts fanden eine Abschlussveranstaltung in Meßkirch und Leibertingen statt. Rund 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer — darunter Landwirte, Vertreter der Naturparke, der Politik sowie Behörden — kamen im Brigel Hof zusammen, um die Ergebnisse der Konzeptstudie zu diskutieren.
Dort wurde beispielsweise über die Frage gesprochen, wie lange sich Humus im Boden aufbauen lässt, bevor ein Sättigungspunkt erreicht ist. Laut Friedrich Wenz, einem der beteiligten Fachberater, kann der Humusaufbau — je nach Ausgangszustand — über Jahrzehnte fortgesetzt werden. Angesichts des vielerorts beobachteten Humusabbaus in Deutschland sei das Potenzial beträchtlich.
Auch die Finanzierungsmöglichkeiten für CO2-Speichermaßnahmen standen im Fokus. Neben klassischen Agrarförderungen bieten inzwischen auch freiwillige Kohlenstoffmärkte Chancen für Landwirte. Mit dem neuen EU-weiten Carbon Removal Certification Framework, das einheitliche Standards und Qualitätskontrollen für CO2-Zertifikate etablieren soll, gewinnt dieser Ansatz zusätzlich an Bedeutung.
Praktische Einblicke auf dem Betrieb Braun-Keller
Den praktischen Abschluss der Veranstaltung bildete eine Exkursion zum Betrieb Braun-Keller. Dort wurden ausgewählte Maßnahmen direkt auf der Fläche vorgestellt. An einer „Bodenbar“ diskutierten die Teilnehmenden mitgebrachte Bodenproben, überprüften Kalkgehalt, Struktur und Verdichtung. Im Anschluss wurde ein Wiesenlüfter der Firma Evers demonstriert, der dabei helfen soll, Bodenverdichtung im Grünland zu reduzieren und das Wurzelwachstum zu fördern.
Zum Abschluss wurde anschaulich erklärt, wie sich ein reduktiver Kompost aufsetzen lässt — inklusive der benötigten Materialien und praktischer Tipps aus dem Betriebsalltag.
Beide vorgestellten Maßnahmen wurden von Herrn Braun-Keller nach der Veranstaltung weiterverfolgt. Den Wiesenlüfter testet er derzeit auf insgesamt zehn verschiedenen Flächen von jeweils 0,25 Hektar, um die Effekte auf Bodenverdichtung und Wurzelentwicklung unter realen Bedingungen zu beobachten. Auch die „reduktive Kompostierung“ bleibt für den Betrieb ein spannender Ansatz: „Wenn der Einsatz auf Flurstücke mit geringem Humusgehalt und schlechter Bodenstruktur konzentriert wird, ist der Aufwand den Nutzen durchaus wert“, so Braun-Keller.
Nachfolgeprojekt läuft an
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts „Landschaft als CO2-Speicher“ ist ein wichtiger Grundstein gelegt. Nun gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse auch über die Modellbetriebe hinaus in die Fläche zu tragen und langfristig tragfähige Lösungen für eine klimaresiliente Landwirtschaft zu etablieren. Im Naturpark Südschwarzwald wird dieser Weg mit dem Anschlussprojekt „Wasser, Boden, Agroforst“ weiterverfolgt.
Landwirtinnen und Landwirte erhalten hier individuelle Beratung und Unterstützung bei der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, der Wasserspeicherfähigkeit und des Nährstoffmanagements. Ergänzend werden Praxis-Workshops, Feldtage sowie Austauschformate für Betriebe angeboten.
Auf die Frage, wie das Projekt weitergeführt werden könnte, um noch mehr Landwirtinnen und Landwirte zu erreichen, betont Herr Braun-Keller: „Noch nicht alle sind sich der Folgen des Klimawandels bewusst. Daher ist es wichtig, zunächst ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sehr der Klimawandel uns Landwirte treffen wird. Erst aus dieser Überzeugung und dem Wissen um die Dringlichkeit kann dann ein echtes Interesse an der Umsetzung entsprechender Maßnahmen entstehen.“










Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.