Resistenzbildung bei Fungiziden vermeiden
- Veröffentlicht am

Fazit
Nutzen Sie für ein optimales Ergebnis viele Möglichkeiten des Resistenzmanagements (Mehrwege-Prinzip):
- gute Bodenfruchtbarkeit sorgt für kräftige Pflanzen
- Eine intensive Bodenbearbeitung,Feld- und Bodenhygiene sowie eine weite Fruchtfolge vermeiden, dass sich Schadderreger anreichern
- Ein angepasster Saatzeitpunkt (nicht zu früh) und eine angepasste Düngung mit optimal ernährten Pflanzen verringern den Befall (Viele Schaderreger profitieren von höheren N-Gaben.)
- Resistente Sorten verringern den Krankheitsdruck
Wenn Fungizide, dann...
- hoch potente Wirkstoffe im Wechsel oder in Kombination mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen in einer Tankmischung verwenden
- keine Kombinationsprodukte mit kreuzresistenten Wirkstoffen verwenden
- empfohlen: Einsatz von Kontaktfungiziden mit multiplen Wirkorten
- Geräte regelmäßig reinigen
- Prognosesystemen zum Krankheitsauftreten nutzen
- Präzisionslandwirtschaft, zum Beispiel Spot-Spraying, wird zukünftig helfen, Pestizide einzusparen
Neue Wirkstoffe sind auch keine Wundermittel
Befindet sich der Pflanzenschutz in einem Teufelskreis? Diese Frage stellte Dr. Bernd Rodemann, Fungizidexperte vom Julius Kühn-Institut Braunschweig, in seinem Beitrag zum Resistenzmanagement auf dem Adama-Fachsymposium Anfang November. Immer mehr Resistenzen, höhere Aufwandmengen, neue Mittel, strengere Auflagen, geringere Vielfalt der Wirkstoffe, mehr Resistenzen. Damit das nicht passiert, arbeitet die Pflanzenschutzbranche bereits an neuen Wirkmechanismen und einer gezielteren Wirkstoffanbindung an die Pflanze, um Resistenzbildung künftig zu reduzieren. Biologicals und die RNA-Interferenz-Technologie werden in Zukunft neue Möglichkeiten der Fungizidkontrolle bieten.
„Das Problem der Resistenzbildung wird nicht allein über den Wirkstoff zu lösen sein“, meint Dr. Rodemann. Er erwartet eine Verschärfung der Zulassungsbedingungen. Im schlimmsten Fall könnten bestimmte Kulturen dadurch ihre Anbauwürdigkeit verlieren. Die Folgen würden den Anforderungen der Ackerbaustrategie widersprechen, so der Wissenschaftler.
Das Mehrwege-Prinzip
„Die Vorbeugung wird eine größere Rolle spielen“, erklärt Dr. Rodemann. Dabei kommt dem Mehrwege-Prinzip eine besondere Bedeutung zu: Eine gute Bodenfruchtbarkeit, optimal ernährte, möglichst resistente Sorten, die Feld- und Bodenhygiene sowie eine abwechslungsreiche Fruchtfolge können den Krankheitsdruck bereits reduzieren. Ernterückstände sollten möglichst rasch abgebaut werden. Es gelte, zu vermeiden, dass sich luft- oder bodenbürtige Schaderreger anreichern.
Als wirksame Stellschrauben im Resistenzmanagement erwies sich zudem, Saatzeitpunkt und Düngung anzupassen. Eine frühe Saat bereits im Herbst fördert beispielsweise den Befall mit Gelbrost und Septoria tritici. Unter hohen Stickstoffgaben breiten sich Schadpilze stärker aus.
Auch der gemeinsame Anbau von Sorten mit unterschiedlichen Resistenzen kann die Zahl der nötigen Behandlungen reduzieren. Dafür müssten die Sorten jedoch hinsichtlich Erntezeit und Struktur zueinander passen. Beim Vertrieb von Getreide in Deutschland komme eine besondere Herausforderung hinzu: Der Handel erwarte Mehle mit bestimmten Eigenschaften, weshalb auch das Korn möglichst homogene Eigenschaften aufweisen sollte.
So sieht die Realität in der Praxis aus
Adama wollte wissen, inwiefern Resistenzmanagementsysteme in der Praxis etabliert sind und führte hierzu von Mai bis Juli 2020 eine Umfrage unter Beratern und Landwirten durch. „Den Beratern zufolge hat ein Drittel der Landwirte ein Problem mit Resistenzentwicklungen gegen Fungizide“, erklärt Dr. Grit Lezovic von Adama. Die Landwirte schätzten die Lage ähnlich ein. Nur die Hälfte der Landwirte fand jedoch, dass die Einhaltung der empfohlenen Aufwandmenge (AWM) wichtig ist. Dabei empfahlen 82 Prozent der Berater, auf die richtige Menge zu achten.
Auch Dr. Rodemann betont die Bedeutung der AWM. Fungizide sollten ausschließlich mit adäquaten Applikationstechniken bei genügend Wasseraufwand und in ausreichender AWM eingesetzt werden – stadiumgerecht und in Abhängigkeit vom Befallsgeschehen.
Wenn Fungizide, dann...
Hoch potente Wirkstoffe sollten im Wechsel oder in Kombination mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen in einer Tankmischung verwendet werden. Empfehlenswert sei zudem der Einsatz von Kontaktfungiziden mit multiplen Wirkorten. Kombinationsprodukte mit kreuzresistenten Wirkstoffen sollten nicht verwendet werden.
Mit Prognosesystemen zum Krankheitsauftreten lässt sich der richtige Anwendungszeitpunkt und -ort besser bestimmen. „Die Chancen der Präzisionslandwirtschaft, Spot-Spraying zum Beispiel, müssen stärker genutzt werden“, findet der Referent. Er plädiert dafür, dass Schadschwellen spezifisch für Sorten, Erreger und Wirkstoffgruppen erarbeitet werden.
Wie stellt sich Adama den Herausforderungen?
Chemische Pflanzenschutzmittel vermeiden weltweit etwa ein Drittel der Ertragsverluste bei Reis, Mais, Kartoffel und Sojabohne. Dadurch konnte in den letzten Dekaden die Produktivität des Ackerbaus massiv gesteigert werden. Diese Intensivierung führte aber auch dazu, dass Fruchtfolgen enger wurden, sich bestimmte Schadorganismen stärker verbreiten konnten und die Pflanzenschutzmittel immer häufiger zum Einsatz kamen. In der Folge passen sich die Schaderreger immer schneller an neue Wirkstoffe und Mittel an.
Die Wirkung vieler Wirkstoffgruppen gegen Septoria hätte bereits nachgelassen, so Dr. Gerd Dingebauer, Leiter der Adama-Fachberatung in Deutschland. Strobilurine haben ihre Wirksamkeit weitgehend eingebüßt, Chlorthalonil hat die Zulassung verloren, Triazole lassen nach und selektieren Dr. Dingebauer zufolge unempfindliche Mutanten. Besser sieht es bei Carboxamiden, Anilinopyrimidinen und Kontaktfungiziden aus. Gegen sie sind bislang noch keine oder wenig Resistenzen bekannt. Carboxamide gilt es als neueste Wirkstoffklasse daher auch mit besonderer Vorsicht einzusetzen, um die Wirkung möglichst langfristig zu erhalten.
Die Sensitivität von Spetoria gegen den Wirkstoff Folpet (z.B. in Folpan 500 SC) hätte jedoch nicht abgenommen. Auch gegen Ramularia erwies sich der Multisite Inhibitor Folpan 500 SC von Adama als wirksames Mittel. Gegen Netzflecken in Gerste hätten sämtliche Wirkstoffklassen nachgelassen. Einzige Ausnahme: Cyprodinil, das beispielsweise im Mittel Bontima Opti enthalten ist.
"Wir werden in den kommeden Jahren erhebliche Wirkstoffverluste zu beklagen haben. Wir müssen einfach Resistenzbildung ernst nehmen, indem wir weniger resistenzbildenede Wirkstoffe verwenden", betont Dr. Dingebauer.




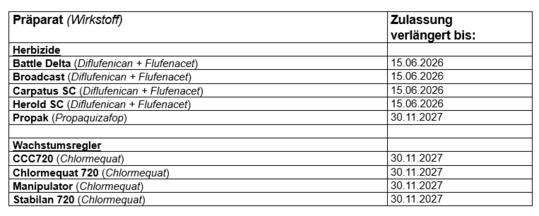
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.