Phosphor: Weniger ist mehr
Kühe und Rinder benötigen für die Erzeugung von Milch und Muskelmasse Phosphor. Doch der tatsächliche Bedarf des Minerals wird häufig überschätzt. Eine Folge der Überversorgung: Bei den meisten Mineralfuttern kann auf den Phosphor-Zusatz verzichtet werden – ein Ergebnis der jüngsten Fachtagung des Landesarbeitskreises Fütterung (LAF) in Erbach-Dellmensingen (Alb-Donau-Kreis).
- Veröffentlicht am

Phosphor übernimmt viele wichtige Funktionen im Körper von Wiederkäuern. 70 bis 80 Prozent des Mineralstoffs stecken im Skelett der Tiere. Dort erledigt Phosphor wichtige physiologische Aufgaben und sorgt etwa dafür, dass Knochen mineralisiert und stabil gehalten werden. Das chemische Element mit dem Symbol P findet sich überdies in Nukleinsäuren, die die Erbinformationen speichern und übertragen. Kreatinphosphat versorgt die Muskeln mit Energie. Phospholipide sind am Aufbau von Zellmembranen beteiligt. Desweiteren steckt Phosphor in der Milch der Kühe.
GfE-Empfehlungen decken Bedarf ab
Wie setzt sich der Bedarf an dem Mineralstoff zusammen? Gibt eine Kuh beispielsweise 30 Kilogramm (kg) Milch pro Tag und frisst hierfür täglich 20 kg Trockenmasse (TM), beläuft sich der Phosphor (P)-Bedarf in der Gesamtration laut Gesellschaft für Ernährung (GfE) auf 71 Gramm (g) P pro Tag für diese Kuh (3,6 g P pro kg TM). Mit weiter steigenden Milchleistungen steigt auch der P-Bedarf an und liegt bei einer Kuh mit einer täglichen Milchleistung von 40 kg Milch bei 90 g P pro Tag (4,1 g P pro kg TM).
Die Zufuhr des Minerals ist notwendig, weil es normalerweise immer zu Verlusten bei der Futteraufnahme der Tiere kommt, wie Prof. Dr. Markus Rodehutscord vom Insitut für Nutztierwissenschaften der Uni Hohenheim den zahlreichen Zuhörern der Fachtagung erläutert und dabei Bedarfswerte der GfE zitiert. Rechnerisch 1,0 g P pro kg TM gehen so verloren. Pro kg erzeugter Milch werden 1,0 g P mit ausgeschieden. Für 1,0 kg Lebendmassezuwachs fällt ein Bedarf von 6,6 bis 7,5 g P an.
Die Verwertung des Mineralstoffes liegt laut dem Tierernährungsexperten bei im Schnitt 70 Prozent– unabhängig davon, um was für Futter es sich handelt. Wieviel des Minerals genau im Grobfutter steckt, lässt sich dabei nicht ein für alle Mal festlegen, da die P-Gehalte stark schwanken können, wie Rodehutscord an einem Beispiel deutlich macht.
So lag der P-Gehalt in 81 Grassilage-Proben aus Bayern (erster Schnitt) im Jahr 2016 im Schnitt bei 3,6 g pro kg TM, ein Jahr später, 2017, waren es durchschnittlich 3,4 g P pro kg TM. Unterm Strich erreichten die vom Landeskontrollverband (LKV) im bayerischen Grub ausgewerteten Proben P-Gehalte von 2,5 bis 4,3 g pro kg TM. Ähnliche Ergebnisse brachte die Auswertung von Grassilageproben (erster Schnitt) in Rheinland-Pfalz, im Saarland, Niedersachsen, Bayern und Hessen. Dort schwankten die P-Gehalte zwischen 2,5 und 4,2 pro kg TM.
Keine Unterschiede mit und ohne Phosphor
Das gilt auch für die P-Gehalte in Getreide, wie Rodehutscord und sein Team vor zwei Jahren in einer Auswertung von Mais-, Gerste-, Weizen-, Triticale-, Roggen- und Hafer-Proben feststellten. Deutlich mehr P in die Ration bringt zudem der Trend zu Rapsextraktionsschrot (RES) als Eiweißquelle. Eine wachsende Zahl von Milchviehhaltern verzichtet inzwischen auf Sojaextraktionsschrot (SES), um dem Anspruch nach einer GVO-freien Fütterung ihrer Kühe gerecht zu werden.
Die Folge: Der P-Gehalt in solchen GVO-freien Rationen steigt. „Das könnte zu neuen Zielkonflikten führen“, befürchtet der Ernährungsexperte. Denn auch die P-Gehalte in Milchleistungsfutter (MLF) würden häufig unterschätzt. Wie Auswertungen des Vereins Futtermitteltest (VFT) zeigen, stecken oftmals mehr als 6 g P in 1,0 kg MLF. „Deutlich mehr als man für die Erzeugung von 1,0 kg Milch benötigt“, wie Rodehutscord argumentiert.
Fütterungsversuche an der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung und Technik (LVA) in Iden (Sachsen-Anhalt), bei denen 38 Milchkühen über 25 Wochen versuchsweise Mineralfutter ohne P (4 g pro kg TM), im anderen Fall Mineralfutter mit P (4,5 g pro kg TM) auf Basis einer Ration aus Gras-, Luzerne-, Maissilage, Getreide und Extraktionsschroten (7,4 MJ NEL, 163 g nXP pro kg TM) vorgelegt wurde, ließ sich kein signifikanter Unterschied bei TM-Aufnahme und Milchleistungen feststellen. Nur die P-Konzentration im Kot fiel bei den Kühen niedriger aus, die das Mineralfutter ohne P bekommen hatten.
Rindermastfutter enthält häufig zu viel Phosphor
Ein Ergebnis, das sich inzwischen in zahlreichen Versuchsdaten wiederholt und bestätigt, wie der Wissenschaftler darlegte. So seien bei P-Gehalten von versuchsweise 3,5 g pro kg TM keine negativen Effekte bei Milchleistung, Zellzahlen und Fruchtbarkeit festgestellt worden, zitiert Rodehutscord Ergebnisse aus drei hierzu initiierten Fütterungsversuchen. Genauso verhielt es sich bei P-Untergrenzen von 3,6 und 3,8 g pro kg TM: Auf Milchleistungen, Futteraufnahme und Fruchtbarkeit wirkten sich diese Gehalte nicht negativ aus.
Ähnliche Resultate lieferten spezielle Untersuchungen zur Fruchtbarkeit bei Kühen. P-Gehalte von 3,5 bis 4,9 g pro kg TM wirkten sich auf das Auftreten der ersten Brunst, der Fortpflanzungsleistung (zwei Jahre), den Progesteronkonzentrationen in Blut und Milch, das Brunstverhalten und die Gelbkörperaktivität (vier Jahre) nicht negativ aus. Fazit des Hohenheimer Tierernährungsexperten: „Eine über die Empfehlungen der GfE hinausgehende P-Versorgung verbessert die Fruchtbarkeit der Kühe nicht.“ Auch die Knochensubstanz leidet bei einer den Empfehlungen folgenden P-Versorgung nicht. Das zeigten Versuche aus den Jahren 2001, 2006 und 2009.
Untersuchungen aus dem Ausland untermauerten vielmehr die Sicherheit der GfE-Empfehlungen, die auch bei einem hohen Leistungsniveau der Kühe sichere Bedarfsangaben lieferten. Allerdings, das stellte Rodehutscord klar, müssten die Rationskomponenten bekannt sein. Der Grund: Die P-Konzentrationen schwanken zwischen und in Einzel- und Mischfuttern.
Die P-Gehalte in Mastbullen-Rationen liegen Auswertungen des VFT zufolge ebenfalls häufig über dem tatsächlichen Bedarf. Der liegt nach GfE-Empfehlungen – abhängig von den Tageszunahmen – bei 4,0 bis 3,5 g P pro kg TM. Tatsächlich finden sich P-Gehalte von 6,0 bis 8,0 g pro kg Mastfutter. Ein Überfluss, der sich auf die Zunahmen der Bullen genauso wenig positiv auswirkt wie das bei Milchleistungsfutter mit hohen P-Gehalten der Fall ist.


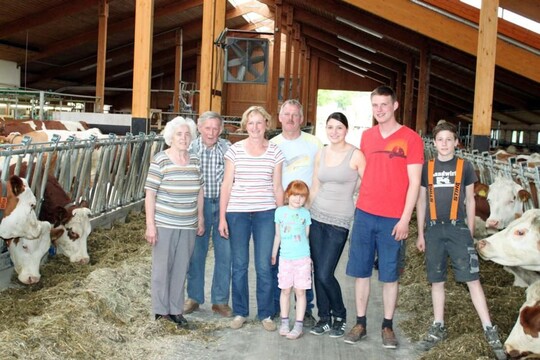






Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.