Saubere Kühe sind weniger euterkrank
Störungen der Eutergesundheit können für Milcherzeuger zu einem erheblichen Kostenfaktor werden. Dabei können die finanziellen Verluste je nach Grad der Erkrankung in einer Größenordnung von 200 bis über 500 Euro pro Kuh und Laktation liegen. Auch als Grund für ungewollte Abgänge von Kühen haben Eutererkrankungen in der Praxis große Bedeutung.
- Veröffentlicht am

Euterentzündungen werden in erster Linie durch das Eindringen von Bakterien über den Strichkanal in das Euter verursacht. Zur Entstehung einer Mastitis müssen aber zusätzlich andere nachteilige Faktoren beim Tier selbst (zum Beispiel reduzierte Abwehrbereitschaft, andere Erkrankungen, Genetik) oder in der Umwelt vorhanden sein, die das Auftreten einer Eutererkrankung begünstigen. Hierzu gehören besonders Unzulänglichkeiten in der Haltung, bei der Hygiene, Fütterung, dem Management oder der Melkarbeit. Dabei stellt sich die Frage, welchen Einfluss unterschiedliche Grade der Sauberkeit bei den Kühen auf die Eutergesundheit haben.
Daten aus Praxisbetrieben
Um eine Antwort auf diese Fragestellung zu bekommen, wurden in einer Praxiserhebung der Hochschule Osnabrück auf Initiative der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Daten zur Sauberkeit der Kühe erfasst. Die Datenerhebung erfolgte in 20 Milchviehbetrieben mit Holstein Friesian-Kühen aus den Landkreisen Emsland und Osnabrück. Die mittlere Herdengröße in diesen Milchviehbetrieben betrug gut 133 Kühe. Das Milchleistungsniveau lag im Jahresdurchschnitt bei 10.270 Kilogramm Milch je Kuh und Jahr mit einer durchschnittlichen Zellzahl von 186.000.
Bereits das hohe Leistungsniveau deutet darauf hin, dass das Fütterungs- und Managementniveau in den ausgewählten Betrieben überdurchschnittlich gut war. Und auch der niedrige Zellzahlwert zeigt, dass die Eutergesundheit in den Herden deutlich besser war als im Durchschnitt der Milchviehbetriebe in Niedersachsen. In einer zufälligen Stichprobe wurden in den Betrieben insgesamt 335 laktierende Kühe hinsichtlich der Sauberkeit in verschiedenen Körperpartien bewertet. bewertet wurde jeweils die Sauberkeit des Euters, der Flanke und des Unterbeins. Als Indikator für die Eutergesundheit wurden für alle bewerteten Kühe die aktuellen Zellzahlen aus der Milchkontrolle erfasst.
Sauberkeit beeinflusst Zellzahl
Den Sauberkeitsbewertungen der Einzelkühe wurden die Zellzahlergebnisse aus der aktuellen Milchkontrolle zugeordnet und daraus Mittelwerte für die einzelnen Klassen gebildet. Bei der Bewertung der Eutersauberkeit wurden keine stark verschmutzten Tiere (Klasse vier) angetroffen. Da bei den Merkmalen Flanke und Unterbein in den Sauberkeitsklassen eins (sehr sauber) und vier (stark verschmutzt) nur eine relativ kleine Anzahl Tiere vertreten war, wurden die Klassen eins und zwei sowie drei und vier in der Darstellung für diese beiden Merkmale zusammengefasst. Wegen der begrenzten Tierzahl und ungleichmäßigen Verteilung auf die einzelnen Sauberkeitsklassen ließen sich die Differenzen zwischen den Zellzahlen in der Untersuchung statistisch nicht absichern.
Dennoch zeigen die absoluten Zahlen, dass es eine nachweisliche Beziehung zwischen der Sauberkeit der Tiere in den verschiedenen Körperpartien und der Höhe der aktuellen Zellzahlen gibt. Am deutlichsten war dies beim Euter festzustellen, wo sich der Zellzahlwert bei den als sehr sauber (durchschnittlich 160.570 Zellen) beziehungsweise sauber bewerteten Eutern (durchschnittlich 204.210 Zellen) auf 446.100 Zellen bei Kühen mit verschmutzten Eutern erhöhte. Das entspricht einer Erhöhung der Zellzahlwerte bei den verschmutzten Kühen im Vergleich zu den beiden anderen Kuhgruppen um etwa das 2,8-fache beziehungsweise 2,2-fache.
Lesen Sie den gesamten Beitrag von Dr. Jakob Groenewold von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der kommenden Ausgabe 40/2019 von BWagrar.

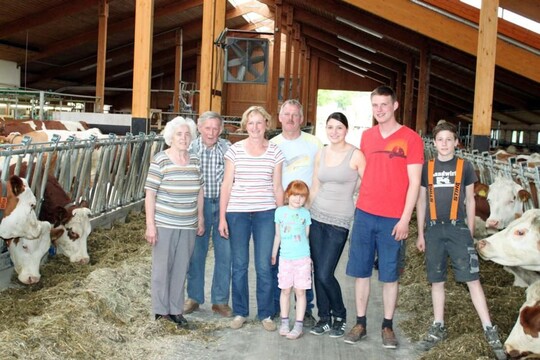








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.