
Öko-Regelungen ohne Effekt
Die mit der jüngsten Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eingeführten Eco-Schemes scheinen in etwa genauso zu wirken wie zuvor das „Greening“, nämlich nur wenig. Dieses negative Fazit ziehen zumindest BirdLife Europe und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in ihrem aktuellen Bericht mit dem Titel „Das ungenutzte Potenzial von Öko-Regelungen“.
von age erschienen am 10.02.2025Die Eco-Schemes, die zur aktuellen GAP als Wegbereiter für mehr Nachhaltigkeit eingeführt wurden, bleiben laut einer Studie von BirdLife Europe und dem NABU weit hinter ihrem Potenzial zurück. Zudem mangle es laut den Naturschützern an einer systematischen und gezielten Überwachung der Öko-Regelungen. Dies erschwere die Bewertung ihrer Wirksamkeit im Hinblick auf die Biodiversitätsziele und die Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten. Laut NABU hat die Analyse von zwölf Mitgliedstaaten im Jahr 2023 gezeigt, dass viele der ausgewählten Öko-Regelungen nur minimale Änderungen der örtlichen landwirtschaftlichen Praktiken erfordern. Dadurch werde zwar das Kriterium „Nachhaltigkeit“ erfüllt, es werde aber de facto keine Verbesserung für Natur und Umwelt erreicht, da lediglich der Status quo gefördert werde.
Um die Öko-Regelungen zum echten „Changemaker“ für die Artenvielfalt zu machen, müssten ökologische Wirksamkeit und eine einkommenswirksame Finanzierung zusammengebracht werden, betont der NABU. Dazu gibt es den Naturschützern zufolge in einigen Mitgliedstaaten effektive Beispiele. Genannt werden hier die in der Slowakei eingeführten Pufferstreifen für den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb und die Initiativen zur Wasserrückhaltung in Polen. Diese Maßnahmen seien vielversprechend.
Nur Flächenziele erreicht
Ein erstes Ergebnis der Analyse war laut NABU, dass die Öko-Regelungen im Durchschnitt die mit ihnen geplanten Flächenziele erreichen. Nach Angaben der EU-Kommission sind inzwischen 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen durch Öko-Regelungen abgedeckt. Aber die Akzeptanz durch die Landwirte sei je nach Mitgliedstaat und Maßnahme sehr unterschiedlich. Die Akzeptanz von Öko-Regelungen mit begrenztem Mehrwert, wie zum Beispiel Nährstoffmanagementregelungen, sei hoch, während die von auf die biologische Vielfalt ausgerichteten Maßnahmen in vielen Ländern gering sei, kritisieren BirdLife Europe und NABU.
Administrative Probleme, unzureichende Werbung und unattraktive Zahlungssätze schränken laut der Analyse die Teilnahme der Landwirte an Regelungen ein, die auf die Artenvielfalt ausgerichtet sind. Kleinere Betriebe waren mit vergleichsweise größeren administrativen Herausforderungen konfrontiert, was ihre Teilnahmequote senkte. Konstruktionsmängel in einigen Regelungen bieten laut NABU Anreize für die Status-quo-Praktiken mit begrenztem Umweltnutzen. In Ländern mit regional zugeschnittenen Regelungen, höheren Zahlungen und flexiblen Menüs – zum Beispiel Spanien und die Niederlande – sei das Engagement größer, auch wenn hier ebenfalls oft weniger ehrgeizigen Maßnahmen der Vorzug gegeben worden sei.
Die zuletzt vorgenommenen Anpassungen der nationalen GAP-Strategiepläne im Anschluss an die Vereinfachung der EU-Agrarpolitik hätten durchweg zu einer Verwässerung der Umweltziele geführt, beklagen BirdLife Europe und NABU. Mehrere EU-Länder hätten die der Natur gewidmeten Flächen reduziert oder erfüllten die Verpflichtungen nur formal.
Empfehlungen der Naturschützer
Ausgehend von ihren Analyseergebnissen geben BirdLife Europe und NABU den Mitgliedstaaten Empfehlungen an die Hand, wie den Öko-Regelungen zu einer besseren Wirksamkeit verholfen werden kann. Angemahnt wird, die Unterstützung bestehender Praktiken auf die Förderung wirkungsvollerer, zukunftsorientierterer Maßnahmen zu verlagern. Die Landwirte müssten für die Umsetzung vorteilhafter Praktiken wirksam belohnt werden, die Zahlungen attraktiver und die Regelungen auf die regionalen Bedingungen und Betriebsarten zugeschnitten sein.
Gefördert werden sollten langfristige Verpflichtungen mit mehrjährigen Zahlungen, damit sich ökologische Vorteile ergeben können. Den Landwirten werde so mehr Sicherheit geboten. Für kleine und benachteiligte Betriebe sei eine gezielte Unterstützung anzubieten. Maßnahmen zur Klimaresilienz und Biodiversität gehören nach Ansicht der Naturschützer ausgeweitet und verstärkt.
Viel Geld und doch wenig Akzeptanz
Zu Deutschland heißt es in dem Bericht, es sei das einzige große Agrarland in der EU, das einen starken Fokus auf die Förderung der Biodiversität gelegt und über 30 Prozent seines Budgets für die Schaffung von Brachflächen bereitgestellt habe. Mit rund 1,6 Milliarden Euro sei die Maßnahme zur „Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität“ das mit Abstand größte Öko-Programm, das unproduktive Flächen über die ursprünglichen GLÖZ-8-Anforderungen von 4,0 Prozent hinaus fördere. Dank des außergewöhnlich hohen Budgets sollte die Maßnahme über alle Teilmaßnahmen hinweg rund 700.000 Hektar abdecken.
Wie aber weiter festgestellt wird, ergab eine erste Evaluierung im Jahr 2023 durch das Bundeslandwirtschaftsministerium eine nur sehr geringe Inanspruchnahme dieses Öko-Programms. Nur 20 Prozent des ersten Prozentsatzes der Regelung seien genutzt worden, und gerade einmal 14 Prozent bei der zweiten Stufe. Auf die anderen beiden Teilmaßnahmen seien lediglich etwa 2,0 Prozent entfallen, was zu einer durchschnittlichen Gesamtbeteiligung von nur 16,5 Prozent geführt habe.
Besserung versprechen sich die Naturschützer von den für 2024 vorgenommen Anpassungen des deutschen Öko-Programms. Eine der „bemerkenswertesten“ Änderungen sei die Erhöhung der förderfähigen nicht produktiven Flächen von sechs auf 8,0 Prozent der Ackerfläche des Betriebs. Diese Ausweitung könnte nach Einschätzung des NABU direkt zur Förderung der Biodiversität in einem größeren Gebiet beitragen.
Positiv bewertet wird auch die jetzt vorgenommene klare Definition von Zeitrahmen für Aussaat und Pflege. So werde sichergestellt, dass die ausgewiesenen Gebiete über einen längeren Zeitraum als Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Wildtiere dienten. So garantiere beispielsweise die Regel, dass Beweidung und Mähen vor dem 1. September verboten seien, dass die Vegetation ausreichend Zeit habe, sich zu entwickeln und um den Arten den notwendigen Schutz und die nötige Nahrung zu bieten.
Jedoch bleibe die administrative Komplexität des Programms eine Herausforderung für die Landwirte, stellt der NABU weiter fest. Die detaillierten Anforderungen würden möglicherweise weiterhin als Barrieren und zu starr wahrgenommen. Dies gelte insbesondere für kleinere Betriebe. Positiv stimmt die Naturschützer in Deutschland aber, dass nach den Anpassungen die Öko-Programme im zweiten Jahr, also 2024, deutlich besser angenommen wurden. Zudem würden 2026 zwei neue Öko-Programme eingeführt, die auf das Grünland und die Vernetzung nicht produktiver Flächen abzielten und das Portfolio weiter ausbauten.




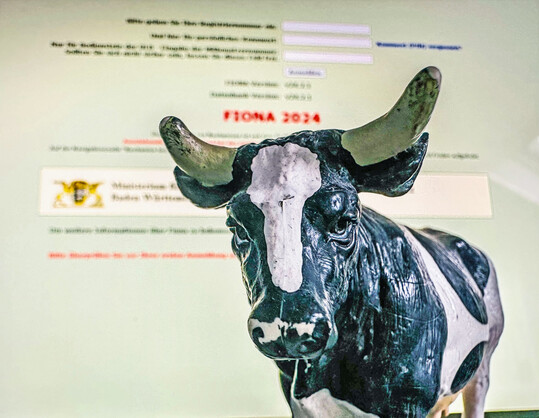




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.