Gen-Schere kommt einer Revolution gleich
- Veröffentlicht am

Seit 2012 machen sich die Wissenschaftler diese molekulare Maschine, wie Scherer die Crispr/Cas Methode bezeichnet, zu Nutze. Der Prozess, den man mit der Methode durchführt, nennt sich Gene Editing. Nach dem Motto: „Mach Dein Gen“ brauche man dazu längst kein High-Tech Labor mehr. „Das geht heute ganz einfach“, so Scherer. Er erklärte die Methode am Milchsäurebakterium zum Joghurt machen, an Streptococcus thermophilus. Scherer zeigte eine Reihenfolge von Genen, darunter das sogenannte Cas 9, ein aktives Molekül, mit dem Gene zerschnitten werden können und den Crispr-Teil. Das Crispr-Stück ist sehr regelmäßig aufgebaut, es besteht aus einer Reihenfolge von immer zwei Elementen, den Rauten und den Boxen. Die Rauten sind Buchstabenfolgen der DNA, die sich laufend wiederholen. Dann gibt es die Teilsequenzen von Bakteriophagen, die Milchsäurebakterien befallen. Jede einzelne Box kennzeichnet einen anderen Bakteriophagen (Viren, die sich über Bakterien ausbreiten). Das Milchsäurebakterium, so Scherer, hat offenkundig ein Gedächtnis. Es merkt sich alle Bakteriophagen, die es jemals ‚gesehen‘ hat und nutzt dies, wenn der gleiche Phage wiederkommt, um ihn zu eliminieren. So funktioniert die natürliche Immunabwehr des Milchsäurebakteriums.
So überleben Bakterien den Phagen-Angriff
Kommt von außen ein unbekannter Phage und injiziert seine DNS in das Milchsäurebakterium, führt dies normalerweise dazu, dass das Milchsäurebakterium abstirbt. Erkennt aber das Bakterium den Phagen-Typ, kann es sich über das Crispr/Cas Gegenstück wehren. Das Bakterieum macht jede Menge Abschriften vom Crispr/Cas Lokus und eine Abschrift davon passt genau auf den Phage. Das Crispr-Cas Enzym bindet sich an den DNA-Teil des Phagen und teilt diesen in Stücke. Damit ist die Infektion abgebrochen. Das Bakterium überlebt den Phagen-Angriff.
Starterkulturen ließen sich resistent machen
„Wir haben in Deutschland Sammlungen von Milchsäure-Phagen, die bei Säuerungsstörungen eine Rolle spielen. Es gibt mehrere 100 von diesen Phagen", so Scherer. Man könnte nun alle bekannten Phagen, von denen man weiß, dass sie Milchsäure befallen, nehmen und aus denen allen die Crispr-Sequenzen herausholen. So müsste man diese Erkennungssequenzen den Streptococcen, also den Starterkulturen hinzugeben. Dann bekäme man einen absolut phagenresitenten Starter, der in allen anderen Eigenschaften unverändert wäre, so Scherer. Und: Ein solcher Starter hätte aber genauso gut durch natürliche Prozesse entstehen können. Wenn ein Milchsäurebakterium häufig genug Kontakt mit den Phagen bekommt, dann passiert das über Jahre und Jahrhunderte von selber. Auch die Natur würde so einen Starter herstellen können, ohne menschliche Einwirkungen, erläuterte Scherer.
Breites Anwendungsfeld für Crispr/Cas
Mit Crispr/Cas kann man neben dem Enzym zum Schneiden (als Reparatur und einfache Mutation) gleichzeitig auch DNS dazugeben, die man an dieser Stelle gezielt einsetzten möchte. Das nennt man gezieltes Genom-Editieren. „Man kann jede beliebige DNS-Sequenz einfügen und die Maschine an jede beliebige Stelle im Genom exakt lenken“, so Scherer. Das funktioniert bei Pflanzen, bei Tieren und auch beim Menschen. „Es gibt keinen Organismus auf dieser Welt, wo Sie die Methode nicht einsetzen können. Die Frage ist, ob wir das wollen“, so Scherer.
Forschergruppe unterstützt Molkereien und Labore
Scherer hat einen Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie am Wissenschaftszentrum Weihenstephan für die Grundlagenforschung einerseits und betreut andererseits auch die angewandte Forschung am Zentralinstitut für Ernährungs- und Lebensmittelforschung ZIEL. Er gehört unter anderem dem Expertenrat für Lebensmittelsicherheit des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz an und gilt als Fachmann in Sachen Hygiene und Mikroorganismen in Milchprodukten. Mit seinen Forscherkollegen unterstützt er die Molkereien und die angeschlossenen Labore, deren Prozesse zu optimieren und Produktionsstörungen zu beheben. So wird derzeit gerade über thermophile Sporenbildner geforscht, die Probleme bei der Herstellung von Milchpulver machen können sowie auch über hitzeresistente Proteasen in Rohmilch. Dabei handelt es sich um Enzyme, die die Haltbarkeit des Produkts verringern. Außerdem gibt es eine eigene Abteilung für Diagnostik- und Industrieberatung.



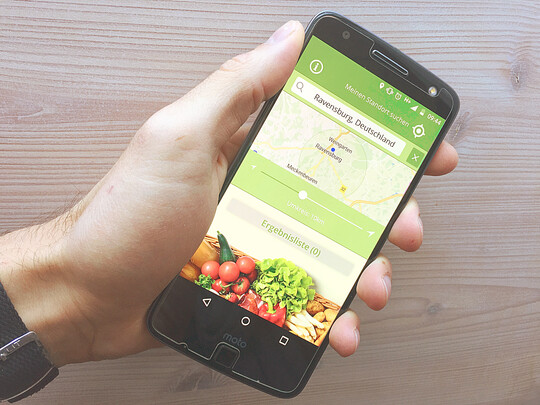


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.