Verbliebene Früchte sorgsam hüten
- Veröffentlicht am

Direkt nach dem Frost hatten Golden, Gala und Pinova die meisten intakten Blüten. Auch Elstar und Fuji hatten häufig noch einen nennenswerten Anteil an Blüten. Bei Gala und Pinova fiel der Blüten- und Fruchtfall aber recht stark aus, sodass trotz genügend überlebender Blüten nun meist ein Unterbehang vorliegt. Bei Fuji sind durch einen starken Nachblütefall häufig kaum Früchte übrig geblieben. Elstar hingegen überraschte vielerorts durch einen erstaunlich guten Fruchtansatz und dürfte damit eine der ertragreichsten Sorten sein. Grundsätzlich sind die später blühenden Lagen weniger stark frostgeschädigt als frühe Lagen, wo es teils in sämtlichen Sorten keinen nennenswerten Ertrag mehr gibt.
Wo noch mit einer Ernte von Tafelware zu rechnen ist, sollten die Früchte gut haltbar und lagerfähig sein. Da alle wichtigen physiologischen Krankheiten wie Stippe, Fleisch- oder Kernhausbräune vom Calciumgehalt abhängen, ist dieser Nährstoff besonders wichtig. Leider ist bei geringem Ertrag der Calciumgehalt in den Früchten von Natur aus zu gering. Mehrmalige Blatt- oder Fruchtdüngungen mit calciumhaltigen Blattdüngern sind dringend anzuraten.
Richtigen Calciumdünger wählen
Bis Anfang Juli konnte Calciumnitrat eingesetzt werden. Ab Mitte Juli sollten für einen sicheren Triebabschluss keine stickstoffhaltigen Calciumdünger mehr verwendet werden. Idealerweise wird dann Calciumchlorid eingesetzt. Günstig und effektiv sind Calciumchlorid-Schuppen. Sie erfüllen die Anforderungen der Düngemittelverordnung, die jedoch gewisse Gehalte an Schwermetallen erlaubt. Bei Anwendungen in größerem Abstand zur Ernte ist dies kein Problem. Für Calciumspritzungen kurz vor der Ernte sollten aber besser garantiert lebensmittelechte Dünger auf Basis von Calciumchlorid wie Düngal Calcium verwendet werden. Durch den Chloridanteil können bei hohen Temperaturen Blattschäden entstehen. In diesen Fällen sind die pflanzenverträglicheren, Calciumformiat-haltigen Dünger wie zum Beispiel Lebosol Calcium Forte besser.
Biobetriebe können weder Calciumnitrat noch -formiat einsetzen. Die EU-Bioverordnung lässt nur den Einsatz von Calciumchlorid zu. Fruchtanalysen der vergangenen Jahre zeigen aber, dass die Calciumgehalte von Bioäpfeln von Natur aus höher sind, weshalb die Gefahr von Nährstoffmangelkrankheiten geringer ist. Dennoch wird in empfindlichen Sorten der Einsatz von Calcium empfohlen.
Zur besseren Erhaltung der grünen Grundfarbe an Äpfeln und Birnen kann im konventionellen Anbau eine zwei- bis dreimalige Anwendung von manganhaltigen Blattdüngern wie Mangannitrat erfolgen. Mangansulfat darf nicht mit Calciumdüngern gemischt werden, da es sonst zu Bildung von Gips im Spritzfass kommen kann.
In Anlagen mit geringem Behang und frostbedingten Qualitätsabstrichen wird man kein Tafelobst ernten. In solchen Beständen gilt es die Kosten gering zu halten. Beim Pflanzenschutz ist dies möglich, wenn zur Bekämpfung von Schorf, Mehltau, Regenfleckenkrankheit, Marssonina und anderen schädlichen Pilzen eine Spritzung nach 30 l Niederschlag mit einem Kupferpräparat in Kombination mit Netzschwefel erfolgt. Mögliche Sonnenbrandschäden durch hohe Temperaturen nach einem Schwefeleinsatz können bei Bäumen ohne Behang toleriert werden.
Schädlinge im Vormarsch
Das Wetter im Juni hat die Vermehrung der Schädlinge begünstigt. Besonders Spinnmilben und Rostmilben haben von der Trockenheit und Hitze mehr profitiert als ihre Gegenspieler, die Raubmilben. Der Schaden an der Vitalität des Baumes durch die kleinen Tiere ist groß. Er sollte durch geeignete Akarizide verhindert werden, bevor die Blätter bronzefarben werden und sich nach oben rollen.
Auffallend ist in diesem Jahr auch das starke Auftreten des Apfelwicklers. Hohe Falterfänge in den Pheromonfallen und ideale Temperaturen in den Abendstunden zur Eiablage haben an unbehandelten Bäumen bereits zu hohen Verlusten durch die erste Generation geführt. Gerade bei schwachem Fruchtbehang ist der Anteil wurmiger Äpfel besonders hoch und kann im Erwerbsobstbau nicht akzeptiert werden. Sowohl im konventionellen wie im ökologischen Anbau sind deshalb mehrmalige Spritzungen mit einem Granulosevirus-Präparat erforderlich. Bei hohem Befallsdruck ist im konventionellen Anbau auch der Einsatz des Insektizids Coragen gerechtfertigt, um mit einer einmaligen Spritzung einen drei- bis vierwöchigen Schutz vor der Obstmade zu haben.





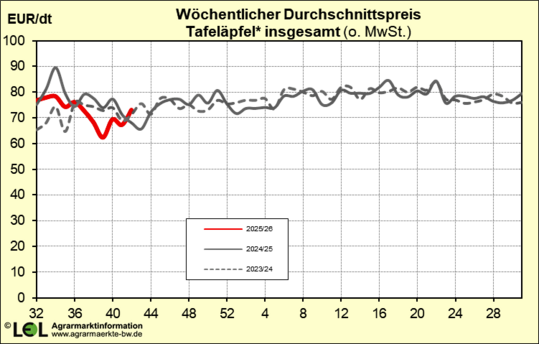



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.