"Hörner gehören zur Kuh – auch im Laufstall"
Über fünf Jahre forschte Demeter gemeinsam mit Bioland und Wissenschaftler*innen der Uni Kassel zur Haltung von behorntem Milchvieh. Das Ergebnis der Studie „Hörner im Laufstall“: Natürlich haben Kühe Hörner – und sie können sie im Laufstall auch behalten.
- Veröffentlicht am

Kühe mit Hörnern auf der Weide – dieses Bild, das in Bilderbüchern Standard ist, spiegelt die Wirklichkeit nicht wider. Heutzutage sind horntragende Rinder fast verschwunden, denn das Enthornen ist weit verbreitet, zudem züchten viele Betriebe genetisch hornlose Tiere, die diese Gene dominant weitervererben. Geschätzt über 90 Prozent aller Milchkühe in Deutschlands Ställen haben bereits keine Hörner mehr. Sicherheit und Wirtschaftlichkeit werden von Milchviehhalter*innen als Gründe für die Haltung enthornter oder genetisch hornloser Rinder genannt.
Intensive Betreuung der Kühe
Die Forscher hinter dem Projekt „Hörner im Laufstall“ zeigt laut den beiden Ökoverbänden Demeter und Bioland jedoch, dass die Haltung horntragender Tiere funktionieren könne. Die beteiligten Praktiker bestätigten, dass die Haltung von horntragenden Rindern auch unter Gesichtspunkten der Arbeitssicherheit möglich sei.
Insgesamt 39 Betriebe begleitete das Forschungsteam über den gesamten Zeitraum seit 2014 mit Beratungsgesprächen und Erhebungen – im Sommer auf der Weide, im Winter im Laufstall. Gerade dort kann es bei behorntem Milchvieh immer wieder zu Problemen kommen: Durch enge Gänge, Konkurrenz am Futtertisch oder ein schlechtes Herdenmanagement entstehen Verletzungen, die Milchleistung der Tiere verschlechtert sich.
Die wissenschaftliche Begleitung zeigte für solche Herausforderungen praktische Lösungswege auf. Der sommerliche Weidegang verhindert die meisten Verletzungen; ein gutes Herdenmanagement bringt Ruhe in die Herde, mehr Platz am Futtertisch sowie breitere Gänge im Stall minderten Konkurrenzsituationen.
Mitautor und Demeter-Berater Ulrich Mück sieht den Schlüssel für die Haltung horntragender Milchkühe im Laufstall darin, das Sozialverhalten der Rinder zu verstehen: „Das genaue Beobachten der Kühe und ein gutes Mensch-Tier-Verhältnis ist die beste Voraussetzung dafür. Leitkühe geben in der Herde den Ton an und fordern ihre Rechte ein; bei Konkurrenzsituationen kann es unter rangniederen Kühen Rangkämpfe geben. In unserem praxisbezogenen Werkzeugkasten haben wir einen Eigencheck und viele Tipps zu Stallgestaltung, Herdenführung und Fütterung zusammengeführt, um Auseinandersetzungen in der Herde zu minimieren.“
Während der Projektlaufzeit stellten 35 der 39 Betriebe ihre Herden von enthornten auf behornte Tiere um, die anderen vier hatten bereits eine behornte Herde. Das Projekt soll auch anderen Betrieben Mut machen, wieder horntragende Milchkühe zu halten: „Unsere Ergebnisse sollen jene Milchviehhalter motivieren, die über eine Bio-Zertifizierung nachdenken. Es soll gleichzeitig Betrieben Entwicklungschancen für eine wesensgemäße und zukunftsfähige Milchviehhaltung geben. Denn eins ist klar: Wenn sich die Landwirte nicht zutrauen, horntragende Rinder zu halten, ist die Gefahr groß, dass es die Kuh mit Hörnern nur noch im Bilderbuch geben wird.“ so Ulrich Mück.
Hintergrund:
Das Projekt: Über fünf Jahre (November 2014 bis Februar 2020) lief das Forschungsprojekt „Hörner im Laufstall: Begleitung von Milchviehherden bei der Umstellung von enthornten auf behornte Tiere oder von Anbinde- auf Laufställe unter Einbeziehung von Modellbetrieben als Basis für eine qualifizierte Beratung in der Milchviehhaltung“. Forscher*innen der Universität Kassel arbeiteten gemeinsam mit Demeter- und Bioland-Berater*innen in vier Regionalgruppen von Milchviehhalter*innen. Die Projektergebnisse wurden in Praxisworkshops, Fachveranstaltungen und Berater*innen-Schulungen geteilt. Bereits letztes Jahr veröffentlichte das Forschungsteam einen Werkzeugkasten, um Betrieben individuelle Lösungsmöglichketen an die Hand zu geben.


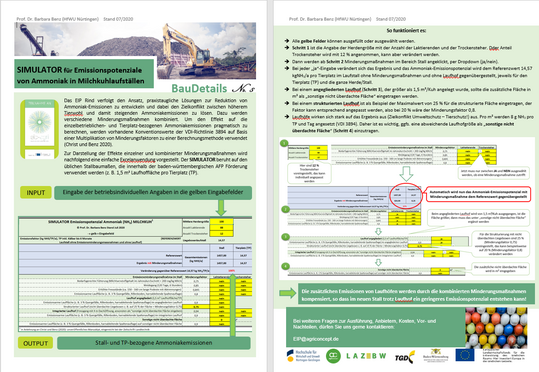








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.