
Plasmabehandlung mit Potenzial
Saatgut sieht sich mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert: Pilzliche Erreger wie Anthraknose, Gerstenflugbrand und Weizensteinbrand bedrohen die Erträge und die Qualität in der Landwirtschaft. Gleichzeitig geraten chemische Beizmittel aufgrund regulatorischer Vorgaben und Umweltaspekte zunehmend unter Druck. In diesem Kontext gewinnt die Erforschung physikalischer Alternativen immer mehr an Bedeutung.
von Redaktion erschienen am 14.05.2025- Kaltes Plasma kann samenbürtige Krankheitserreger wirksam reduzieren und ist eine mögliche Alternative zur chemischen Beizung.
- In Feldversuchen wurden Verbesserungen bei Saatguthygiene und Ertrag – insbesondere bei Wintergerste – nachgewiesen.
- Ökolandbau im Fokus: Das Verfahren bietet Potenzial für den Einsatz im Biolandbau, wo chemische Mittel stark eingeschränkt sind.
- Zugang zu natürlich infiziertem Saatgut und geeigneten Flächen bleibt schwierig.
- Forschung geht weiter: Für eine breite Anwendung sind weitere Studien zu Langzeitwirkung und Variabilität notwendig.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten WIR!-Bündnisses Physics For Food führten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Forschungsprojekt Physics For Seed Treatment durch. In diesem Projekt untersuchten sie die Saatgutdesinfektion mittels kaltem Plasma. Das Ziel bestand darin, eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative zur chemischen Beizung zu entwickeln. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Plasmabehandlung in bestimmten Fällen eine ähnlich gute Wirkung wie etablierte Verfahren erzielt hat“, erklärt die Projektleiterin Dr. Nicola Wannicke vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. (INP).
Darüber hinaus konnten positive Effekte auf den Feldaufgang und den Ertrag nach der Plasmabehandlung festgestellt werden. An einem Standort für Wintergerste zeigte sich im Jahr 2023 ein Mehrertrag von rund sechs Dezitonnen pro Hektar. Dieser zusätzliche Effekt zur verbesserten Saatguthygiene könnte einen besonderen Anreiz für eine zukünftige Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis bieten.
Fokus auf samenbürtige Krankheiten
Im Rahmen des Projekts wurde die Bekämpfung von Flugbrand bei Gerste und von Weizensteinbrand bei Weizen untersucht. Beide Erreger können erhebliche Schäden verursachen und die Keimfähigkeit der Pflanzen deutlich beeinträchtigen. Die Laborversuche belegten die Wirksamkeit der Plasmabehandlung bereits überzeugend. Ergänzende Feldversuche lieferten wertvolle Erkenntnisse zur praktischen Anwendung unter realen Bedingungen.
Gerade im Ökolandbau könnten die Forschungsergebnisse von großer Bedeutung sein, da der Einsatz von chemisch behandeltem Saatgut stark eingeschränkt ist. „Wenn künftig nur noch Saatgut verwendet werden darf, das über Jahre unbehandelt geblieben ist, könnten sich bestimmte Krankheiten schnell ausbreiten“, warnt Dr. Andreas Jacobi von der Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG. KG. „Die Plasmatechnologie könnte hier eine entscheidende Lösung bieten, um dieses Risiko zu minimieren.“
Eine besondere Herausforderung im Projekt war die Beschaffung von natürlich infiziertem Saatgut, das für praxisnahe Tests benötigt wird, aber am Markt kaum erhältlich ist. Feldversuche mit Weizensteinbrand erwiesen sich zudem als besonders anspruchsvoll, da der Erreger in den Boden übergehen kann. Geeignete Flächen zu finden, war schwierig, da viele Landwirte verständlicherweise Zurückhaltung gegenüber einer möglichen Kontamination ihrer Felder zeigten.
Weiterführende Forschung notwendig
Trotz des erfolgreichen Projektabschlusses besteht weiterer Forschungsbedarf. „Die bisherigen Ergebnisse sind zwar sehr vielversprechend“, erklärt Dr. Nicola Wannicke, „aber für eine flächendeckende Anwendung in der Praxis müssen wir erstens die Wirksamkeit der Plasmabehandlung unter unterschiedlichen Bedingungen belegen und zweitens ihre langfristigen Effekte auf die Saatgutqualität und die Pflanzenentwicklung noch intensiver untersuchen.“
Im Jahr 2018 haben die Hochschule Neubrandenburg, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. (INP) sowie mehrere Wirtschaftsunternehmen das Innovationsbündnis „Physics For Food – Eine Region denkt um!“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern entwickeln sie seither neue physikalische Verfahren für die Landwirtschaft und die Lebensmittelverarbeitung. Dabei kommen unter anderem Atmosphärendruck-Plasma, gepulste elektrische Felder und UV-Licht zum Einsatz. Das Ziel besteht darin, Agrarrohstoffe zu optimieren, Schadstoffe in der Lebensmittelproduktion zu minimieren, chemische Saatgutbeizen zu ersetzen und Pflanzen widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu machen. Das Bündnis wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Initiative WIR! – Wandel durch Innovation in der Region gefördert (Förderkennzeichen 03WIR2810).





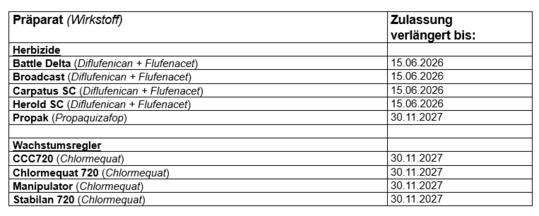
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.