Künftig keine S-Klasse mehr
- Veröffentlicht am

Unsere Vereine konnten wie bisher ihre Aufgaben zur Erhebung der Milchgüte und Absicherung der Rückstandsfreiheit bestens meistern“, zeigte sich der Vorsitzende Manfred Olbrich zufrieden mit der geleisteten Arbeit im vergangenen Jahr. Der Milchprüfring hat im Jahr 2017 fast 24,5 Mio. Untersuchungen auf 4,5 Mio. Rohmilchproben von 6218 Erzeugern durchgeführt. Neben dem Milchprüfring als Verein, gibt es seit einigen Jahren die Milchprüfring GmbH. Dabei handelt es sich um eine Zertifizierungs- und Kontrollstelle mit neun Mitarbeitern. Durch den Boom für ohne Gentechnik-Anerkennung, aber auch für Heumilch oder Ursprungsangaben gab es im vergangenen Jahr 4800 Audits. Der Milchwirtschaftliche Verein deckt die fachlichen und rechtlichen Themen in Sachen Milch in Baden-Württemberg ab. Dazu gehören auch Verbraucherveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel der gemeinsame Auftritt der Molkereien beim Landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart. Im Jahr 2017 gab es unter anderen 97 Aktionen in Schulen, 74 Verbraucherseminare sowie einen Käsekuchenwettbewerb, der sehr gut angenommen wurde.
Neue Verordnung wird zur Herausforderung
Wichtiges Thema ist die neue Milchgüteverordnung, mit der die Branche bereits seit Jahren rechnet und die jetzt im kommenden Jahr tatsächlich in Kraft treten soll. Unverändert bleiben in der neuen Verordnung die Gütemerkmale. Die S-Klasse wird abgeschafft. Die Umrechnung von Liter in Kilogramm erfolgt künftig mit dem Faktor 1,03 statt bisher 1,02. Es werde eine Mengengewichtung für Fett und Eiweiß kommen, ebenso neue Standards für die Hemmstoffuntersuchung. Die Umstellung auf die neue Verordnung werden als große Herausforderung gesehen, weil der Umfang der Verordnung deutlich zugenommen habe (alte Version: fünf Seiten mit acht Paragrafen/neue Version: 42 Seiten mit 22 Paragrafen).
Futter könnte knapp werden
Olbrich lobte die gute Zusammenarbeit der Milchwirtschaft in Baden-Württemberg insgesamt. Dieser Schulterschluss komme letztlich allen Milchbauern zugute. Das Milchwirtschaftsjahr 2017 insgesamt sei ein gutes Jahr gewesen. Im laufenden Jahr jedoch fehlten vor allem im Norden Baden-Württembergs die Niederschläge. „In meiner Gegend ist auf dem Grünland seit dem zweiten Schnitt fast nichts mehr gewachsen“, so Olbrich. Die Maisernte startete bei ihm bereits am 12. August. Entsprechend wird seit Mitte August aus den Vorräten gefüttert. So kann sich zwar die Mehrzahl der Betriebe mit ihrem Futter über den Winter retten, danach könnte es knapp werden.
Tierwohl im Fokus
Die Verbesserung des Tierwohls sei weiterhin das zentrale Thema in der Branche, berichtete der Geschäftsführer der beiden Vereine, Dr. Markus Albrecht. Der Vorstand des Milchwirtschaftlichen Vereins hatte in Sachen Anbindehaltung ein gemeinsames Positionspapier für die süddeutsche Milchwirtschaft erarbeitet. Zumindest auf Landesebene hat man eine gemeinsame Position gefunden, wenngleich sich der große Wurf leider nicht durchsetzen konnte. „Wir werden die Diskussionen weiterführen müssen“, so Albrecht.
Eigenkontrolle zunehmend gefragt
Bei dem Programm für mehr Tierwohl im Land von der Hochschule Nürtingen mit dem MLR und dem LAZBW handelt es sich um ein vielversprechendes Managementtool für interessierte Betriebe zur Eigenkontrolle. Der Milchprüfring werde die neue App, die die Landestierschutzbeauftragte auf ihrer Homepage stellen möchte, positiv begleiten, so Albrecht. Die Eigenkontrolle werden immer mehr kommen. Dass der Handel beim Tierwohl zunehmend neue Forderungen erhebt, ohne dafür zu bezahlen, macht den Molkereien und Landwirten zu schaffen. „Diese Diskussionen sind für uns nur begrenzt erfreulich“, so Albrecht. Im Gespräch sei ein zentrales Betriebsregister für QM-Milch Betriebe, um im Krisenfall direkt auf die Betriebe zugreifen zu können. Die Molkereien und der Milchindustrieverband (MIV) lehnen dies vehement ab.
Zahl der Erzeuger geht zurück - gute Zusammenarbeit mit dem LKV
Der Milchprüfring ist an 18 Molkerei-Standorte angeschlossen und arbeitet für über 6000 Milcherzeuger. Das Tagesgeschäft läuft im Labor in Kirchheim/Teck sowie an sechs Außenstellen. Im Jahr 2017 gab es bei den Milcherzeugern wegen des Strukturwandels und der Abwanderung nach Bayern einen Rückgang von insgesamt 14 Prozent – davon allein sieben Prozent wegen Standortverlegungen der Molkerei Arla. Langfristig rechnet Albrecht mit 4000 Milcherzeugern plus x im Land. 55 Prozent des Aufwandes des Milchprüfrings sind Milchgüteuntersuchungen, 15 Prozent Trächtigkeitsuntersuchungen, ein noch junges Geschäftsfeld, das sich sehr gut entwickelt habe sowie Rückstandsanalytik. In der Mikrobiologie gab es in Sachen Schadkeimdifferenzierung eine Verdopplung der Proben. Ein Trend, der in diesem Jahr zunehmen dürfte. Die restlichen 30 Prozent seien Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um die Milchleistungsproben für den Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. (LKV). LKV-Geschäftsführer Dr. Friedrich Gollé-Leidreiter bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Er berichtete, dass im LKV 88 Prozent der Milchviehhalter vereint seien und dass man gerade dabei sei, ein System der Eigentrolle umzusetzen. Ziel sei es, die vorhandenen Daten der Milchleistungsprüfung, der Milchgüte und des HIT-Daten-Systems und des QM-Milch-Systems zu bündeln, um ein schlankes neues System für die Milcherzeuger zu entwickeln.
Joachim Hauck sagt Danke
Ministerialdirigent Joachim Hauck, der im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen wird, bedankte sich bei den beiden Vereinen für ihr großes Engagement. „Dieses Jahr hat uns gezeigt, dass im Milchbereich Veränderungen stattfinden, die man sich in der Vergangenheit nicht hätte vorstellen können. Milcherzeuger stehen plötzlich ohne Abnehmer da“, meinte Hauck mit Blick auf die BMG-Pleite. Dies beobachte er mit großer Sorge. Umso mehr freue er sich über alle Betriebe im Land, die erfolgreich Milch erzeugen und verarbeiten. „Wir müssen schauen, wie wir im Land unsere Vorteile am besten ausspielen können“, so Hauck. Investitionen durch die Anforderungen des Marktes seien ein wichtiges Thema. In Südbaden habe man eine 100 Prozent Stelle zur Beratung der Betriebe, die ihre Anbindehaltung umstellen wollen, eingerichtet. Außerdem gebe es neues Förderungsmodul für die Umstellung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung.
Wahlen in die Gremien
Bei den Wahlen in den Vorstand wurden für den Milchwirtschaftlichen Verein Heinz Kaiser, Schwarzwaldmilch und Jakob Ramm, Milchwerke Schwaben, wiedergewählt. Neu ins Gremium gewählt wurde Dr. Johannes Eder, Omira. Für den Milchprüfring wählten die Mitglieder Johannes Eder, Omira, sowie Franz Käppeler, BLHV und Rainer Treiber, Landwirt und Vorsitzender des Vorstandes bei der MEG Nordbaden, in den Vorstand.
Neue Methode in der Biologie
Was man in den Biowissenschaften mit der so genannten Gen-Schere alles machen kann, erklärte Prof. Dr. Siegfried Scherer Gen-Schere kommt einer Revolution gleich. Der Wissenschaftler aus München hat einen Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie am Wissenschaftszentrum Weihenstephan und forscht am Zentralinstitut für Ernährungs- und Lebensmittelforschung ZIEL. Als geradezu revolutionär bezeichnete Scherer die Crispr/Cas-Methode. Bei ihr handelt es sich ein molekulares Werkzeug, durch welches man Erbsubstanz einfach und gezielt verändern kann. Es werden Enzyme in Zellen gegeben. Mit Hilfe der Enzyme lässt sich dann die DNA gezielt an bestimmten Stellen schneiden und verändern. „Dazu braucht man kein High-Tech Labor“, so Scherer. In den USA gibt es bereits günstige Baukästen, mit denen man Gene verändern kann.






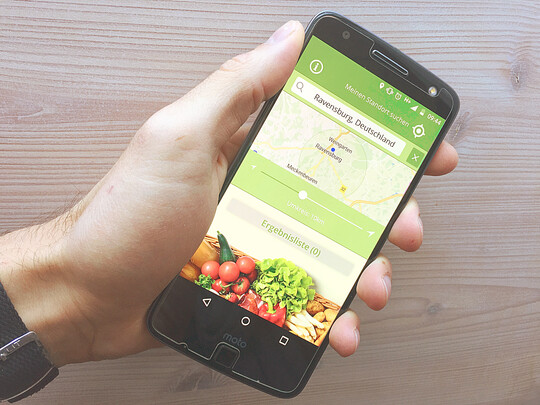


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.