Biodiversität gemeinsam voranbringen
- Veröffentlicht am

Die Vorträge der Dame und der Herren aus den Ministerien (siehe unten) lassen an diesem Tag die infolge der Pandemie und Marktentwicklungen nicht vorhandene Weihnachtsstimmung erst gar nicht aufkommen. Vielmehr bedeuten die Ausführungen der Fachleute zur Stärkung der Biodiversität und Umsetzung der Dünge-Verordnung mit all den Verboten und Auflagen teils schwere Kost. Dies zeigt sich an zahlreichen Fragen aus der landwirtschaftlichen Praxis, welche Vorstandsmitglieder in der Diskussion vorbringen.
Aus Sicht der Praktiker lassen die Antworten der Experten öfters weitere Fragen aufkommen. Deren Versicherung, die Herausforderungen in Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz angehen und meistern zu wollen, scheinen manchem Vorstandsmitglied in der Praxis fraglich, jedenfalls angesichts einiger Äußerungen auf weitere Fragen.
Fragen gemeinsam beantworten
Joachim Rukwied nimmt so ein Stichwort von Naturschutz-Abteilungsleiter Karl-Heinz Lieber vom Umweltministerium zur Kooperation mit der Landwirtschaft auf. Der Präsident des Landesbauernverbandes appelliert überdeutlich, die Aktivitäten zur Stärkung der Biodiversität und die Maßnahmen zur Umsetzung der Dünge-Verordnung in der Praxis gemeinsam zu gestalten.
Und in seinem Schlusswort der Webkonferenz legt Rukwied nach. Bevor er den Vorstandsmitgliedern für die Zusammenarbeit dankt und guten Rutsch wünscht, zieht er noch in Anwesenheit der Gäste ein vielsagendes Fazit der Diskussion. Viele Informationen seinen ausgetauscht, zahlreiche Impulse gegeben. Er sei „zuversichtlich, offene Fragen gemeinsam besprechen zu können“.
Vorfreude auf Zusammenarbeit
Zu Beginn der Webkonferenz hatte Rukwied die neue Landesvorsitzende der Landjugend Württemberg-Baden, Stefanie Vollert, im Vorstand des Landesbauernverbandes (LBV) begrüßt. Er freut sich auf gute Zusammenarbeit, wie er unterstreicht.
Mit Freude nimmt der LBV-Präsident die Äußerung des scheidenden Landjugend-Vorsitzenden zur Kenntnis. Peter Treiber hatte sich in seiner kurzen Abschiedsrede bereit erklärt, auch im Kreisbauernverband mitzuarbeiten. „Wir brauchen mehr junge Leute, die sich im Verband engagieren“, dankt Rukwied Treiber „doppelt“ für die gute Zusammenarbeit.
Rukwied heißt neue Mitarbeiter im Landesbauernverband (LBV) willkommen. Mit Ina Jungbluth, neuer Referentin für „Tierhaltung“, habe er bereits im Deutschen Bauernverband (DBV) erfolgreich zusammengearbeitet. So ist der Präsident überzeugt, dass dies „auch in Stuttgart gelingt“ (Weitere Informationen hier).
Ebenso freut er sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Referenten für „Pflanzliche Erzeugung“, Dr. Dominik Modrzejewski (Weitere Informationen hier).
Handel hält in Atem
In seinem agrarpolitischen Bericht fasst Rukwied Unternehmensergebnisse 2019/20 zusammen und verweist unter anderem auf die aktuelle Krise im Schweinesektor. Aber nicht nur dort sei die Einkommenssituation der Landwirte schwierig. So macht der Weinbau Sorge, liegen die Rindermäster bei den Unternehmensergebnissen auf dem letzten Platz. Die wirtschaftliche Lage in der Landwirtschaft sei „nach wie vor angespannt“ (Nähere Informationen hier).
Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) – aber nicht nur dieser – hält den Bauernverband in Atem. Wie der LEH-Brief an die Bundeskanzlerin und Bundesernährungsministerin zeige, komme aus dessen Reihen der härteste Widerstand gegen die EU-Richtlinie zu unlauteren Handelspraktiken. So hat der Bauernverband ein detailliertes Forderungspapier dazu auf den Weg gebracht. Gerade werde „auf dem Rücken der Bauern“ viel Geld verdient. Zahlreiche Gespräche laufen, um die Forderung nach einem Deutschland-Bonus für höhere Standards „im Markt zu implementieren“.
Erfolge auch in schwieriger Zeit
Auch in schwieriger Zeit erzielt der Bauernverband Erfolge. So verweist Rukwied unter anderem auf das Jahressteuergesetz. Danach soll für Betriebe mit bis zu 600.000 Euro Jahresumsatz die Pauschalierung der Umsatzsteuer erhalten bleiben (Weitere Informationen hier und hier).
Durch massiven Einsatz hatte es der Bauernverband zum Abbau der Schweinestaus erreicht, Schlachtbetriebe aus der Stilllegung wieder in den Betrieb zu bringen.
Hinsichtlich der zukünftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) setzt Rukwied darauf, „dass der Trilog jetzt zügig beendet und die neue Politik im neuen Jahr beschlossen wird“. Dazu führt der Bauernpräsident zahlreiche Gespräche mit EU-Abgeordneten und EU-Kommissaren. Als ein „Unding“ und „unerträglich“ bezeichnet der Bauernpräsident die Einmischung von Frans Timmermans, Vize-Präsident der EU, „in Beschlüsse des Europäischen Parlaments“.
In Atem hält auf Bundesebene unter anderem das Thema Insektenschutz. Hier hat Rukwied die Ministerpräsidenten mit dem Ziel angeschrieben, zu verhindern, „dass durch Bundesmaßnahmen im Aktionsprogramm Insektenschutz all das konterkariert würde, was beispielsweise in Baden-Württemberg mit Landesprogrammen erreicht wurde und wird“ (Weitere Informationen hier).
Die Mitarbeit von Saison-Arbeitskräften bleibe auch im neuen Jahr eine große Herausforderung: „Wir müssen schauen, schon im Februar ausreichend Saison-Arbeitskräfte zur Verfügung stellen zu können“, betont Rukwied.
Herausfordernd und spannend bleibe es auch im neuen Jahr, verweist der Präsident unter anderem auf die Landtagswahlen im Frühjahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie auf die Bundestagswahlen im Herbst. Um die Positionen und Forderungen des Berufsstandes an die Politik zu übermitteln, veranstaltet der Bauernverband im neuen Jahr zahlreiche agrarpolitische Diskussionen per Webkonferenz.
Vier Ministerialbeamte beim Landesbauernverband
Vier Vertreter aus den Ministerien für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) sowie Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) standen im LBV-Vorstand Rede und Antwort:
- Dr. Helga Pfleiderer, Referat „Pflanzenproduktion, produktionsbezogener Umweltschutz“ im MLR, erklärte die Ausweisung sowie Maßnahmen in Nitrat- und eutrophierten Gebieten.
- Dr. Konrad Rühl, Abteilungsleiter „Landwirtschaft“ im MLR, gab einen Überblick über die Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 und die Umsetzung des Biodiversitäts-Stärkungsgesetzes.
- Karl-Heinz Lieber, Abteilungsleiter „Naturschutz“ im UM, erläuterte Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität.
- Dr. Thomas Mader, Referat „Boden, Altlasten, Grundwasserschutz und Wasserversorgung“ im UM, sprach über die Zustandsbeurteilung der Grundwasserkörper nach der Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) und die Ausweisung mit Nitrat belasteter und eutrophierter Gebiete gemäß Dünge-Verordnung.





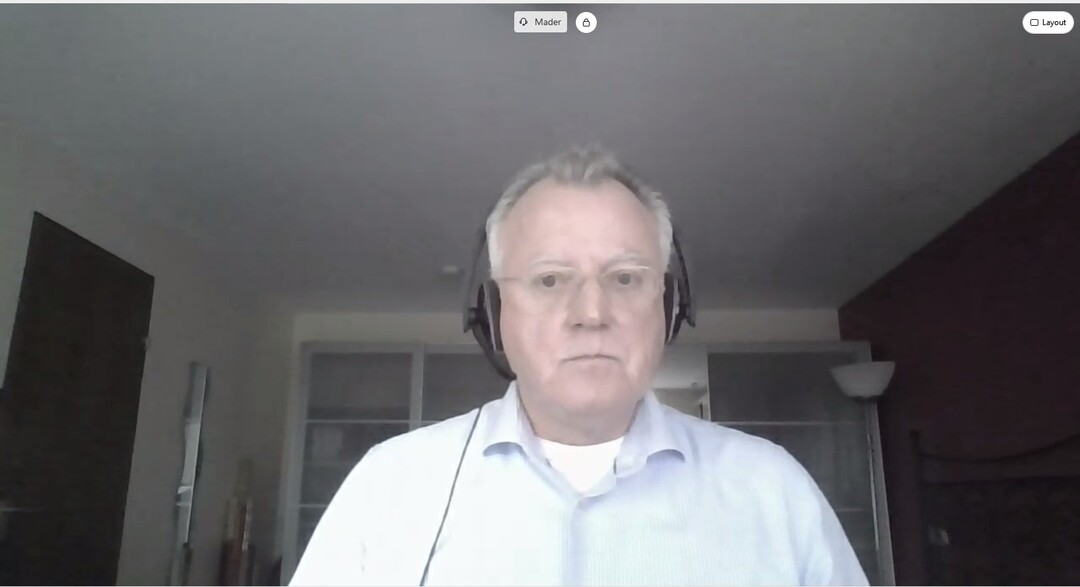









Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.